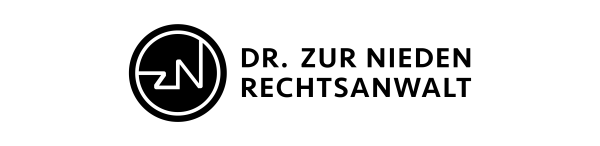Viele Arbeitnehmer fragen sich im Zusammenhang mit einer Kündigung, ob ihnen eine Abfindung zusteht. Die Antwort lautet: Nicht automatisch – aber unter bestimmten Voraussetzungen ja. Dieser Beitrag gibt einen Überblick darüber, wann und wie eine Abfindung gezahlt werden kann, was dabei zu beachten ist und welche Rolle eine Kündigungsschutzklage spielt.
1. Abfindung aufgrund gesetzlicher Regelung: § 1a KSchG
Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) regelt im § 1a eine spezielle Form der Abfindung: Wenn der Arbeitgeber eine betriebsbedingte Kündigung ausspricht und im Kündigungsschreiben ausdrücklich auf die Möglichkeit einer Abfindung hinweist, entsteht ein gesetzlicher Anspruch auf Abfindung, sofern der Arbeitnehmer keine Kündigungsschutzklage erhebt.
Voraussetzungen für eine Abfindung nach § 1a KSchG:
- Das KSchG muss anwendbar sein (mehr als 6 Monate Betriebszugehörigkeit und Betrieb mit mehr als 10 Arbeitnehmern).
- Der Arbeitgeber kündigt betriebsbedingt.
- Im Kündigungsschreiben wird auf § 1a KSchG und die Abfindung hingewiesen.
- Der Arbeitnehmer lässt die 3-Wochen-Frist für eine Klage verstreichen.
Die Höhe der Abfindung:Sie beträgt gesetzlich 0,5 Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr. Angefangene Jahre über 6 Monate werden auf ein volles Jahr aufgerundet.
Wichtig: Dieser Abfindungsanspruch entsteht nur, wenn der Arbeitgeber freiwillig die Bedingungen des § 1a KSchG in der Kündigung explizit benennt. Es handelt sich also nicht um einen automatischen Anspruch bei jeder betriebsbedingten Kündigung.
2. Abfindung durch Vergleich im Kündigungsschutzprozess
Der weitaus häufigere Weg zur Abfindung führt über die Kündigungsschutzklage. Viele Kündigungen halten einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand oder sind zumindest angreifbar. Arbeitgeber sind dann oft bereit, sich auf einen Vergleich einzulassen und eine Abfindung zu zahlen, um das Verfahren zu beenden.
Ein Vergleich kann sinnvoll sein:
- wenn die Wirksamkeit der Kündigung zweifelhaft ist,
- wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich gütlich trennen wollen,
- wenn der Arbeitnehmer schnell eine neue Stelle findet und lieber eine Zahlung als eine Rückabwicklung will.
Die Höhe der Abfindung ist hier Verhandlungssache, orientiert sich aber oft ebenfalls an der Formel "ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Jahr" – kann jedoch deutlich höher oder niedriger ausfallen.
3. Aufhebungsvertrag und Abwicklungsvertrag
Eine Abfindung kann auch im Rahmen eines freiwilligen Aufhebungsvertrags vereinbart werden. Hier trennen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich – oft gegen Zahlung einer Abfindung. Auch Abwicklungsverträge, die nach Ausspruch einer Kündigung geschlossen werden, enthalten häufig Abfindungsregelungen.
Arbeitnehmer sollten jedoch dringend rechtlichen Rat einholen, bevor sie einen solchen Vertrag unterschreiben: Es drohen sonst Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld, wenn der Eindruck entsteht, das Arbeitsverhältnis sei auf Wunsch des Arbeitnehmers beendet worden.
4. Sozialplan-Abfindung
Bei größeren Umstrukturierungen, Betriebsschließungen oder Massenentlassungen sehen viele Sozialpläne Abfindungszahlungen vor. Diese werden zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbart und gelten für alle betroffenen Arbeitnehmer. Eine Abfindung nach § 1a KSchG kann zusätzlich gewährt werden, wenn keine Anrechnung im Sozialplan vorgesehen ist.
5. Fazit
Wann lohnt sich der Blick auf die Abfindung?
Ein gesetzlicher Anspruch auf Abfindung ist nicht die Regel, kann aber entstehen – entweder durch die spezielle Regelung des § 1a KSchG oder durch Verhandlung im Rahmen eines Rechtsstreits oder einer gütlichen Einigung. In jedem Fall empfiehlt sich die frühzeitige Beratung durch einen Anwalt, um Chancen, Risiken und Höhe einer möglichen Abfindung richtig einschätzen zu können.
Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine individuelle Rechtsberatung, sondern bietet eine erste Orientierung. Kontaktieren Sie mich gern, wenn Sie Fragen zu Ihrer konkreten Situation haben.