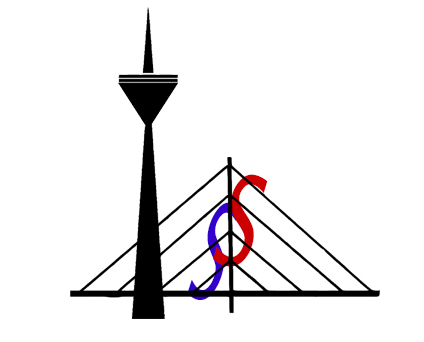Der Alkoholpegel sinkt langsamer als das schlechte Gewissen. Vielen Autofahrern ist nicht bewusst, dass sie noch unter dem Einfluss von Alkohol stehen, wenn sie sich morgens ans Steuer setzen. Oder sie unterschätzen die Folgen eines spontanen Entschlusses nach einem geselligen Abend. Was als kleine Unachtsamkeit beginnt, endet nicht selten in einem Strafverfahren – mit langfristigen Konsequenzen für Führerschein, Beruf und finanzielle Existenz.
In diesem Rechtstipp erfahren Sie, wann eine Alkoholfahrt strafbar ist, worin der Unterschied zwischen § 316 und § 315c StGB liegt, und welche rechtlichen, versicherungsrechtlichen und beruflichen Risiken bestehen.
1. Was regeln § 316 und § 315c StGB?
Die Vorschriften betreffen unterschiedliche Schweregrade von Fahrten unter Alkoholeinfluss:
§ 316 StGB – Trunkenheit im Verkehr
Diese Norm bestraft das Führen eines Fahrzeugs trotz Fahruntüchtigkeit infolge von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Maßgeblich ist, ob die Fahrt sicher hätte durchgeführt werden können.
- Absolute Fahruntüchtigkeit liegt bei 1,1 Promille oder mehr vor – unabhängig vom Fahrverhalten.
- Relative Fahruntüchtigkeit beginnt ab 0,3 Promille, wenn zusätzliche Ausfallerscheinungen (z. B. Schlangenlinien, Bremsfehler, Rotlichtverstöße) hinzukommen.
Erfasst sind dabei alle Fahrzeugführer – also auch Fahrradfahrer, E-Scooter-Fahrer und Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen.
§ 315c StGB – Gefährdung des Straßenverkehrs
Dieser Straftatbestand setzt über den reinen Alkoholkonsum hinaus, dass der Fahrer:
- unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht und
- dabei konkret andere Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet.
Es handelt sich um ein sogenanntes Gefährdungsdelikt:
Es genügt nicht, fahruntüchtig zu sein – es muss eine konkrete Gefahr realisiert worden sein, etwa durch riskantes Überholen, Beinahe-Kollisionen oder Missachtung von Verkehrsregeln.
2. Strafrechtliche Konsequenzen
§ 316 StGB:
- Geldstrafe oder
- Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr,
- 3 Punkte in Flensburg,
- Fahrverbot oder
- Entziehung der Fahrerlaubnis,
- MPU-Anordnung bei Wiedererteilung möglich.
Bereits Ersttäter mit einem Wert über 1,1 Promille müssen regelmäßig mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.
§ 315c StGB:
- Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren,
- regelmäßig Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB),
- Strafverfahren mit Eintrag im Führungszeugnis,
- Bewährungsstrafe oder Haft bei schweren Gefährdungen oder Wiederholung.
In der Praxis ist § 315c besonders bei Verkehrsunfällen mit Alkoholeinfluss relevant. Auch ohne Personenschaden droht hier eine deutlich höhere Strafe als bei § 316.
3. Versicherungsrechtliche Risiken
Ein oft unterschätztes Risiko sind die Folgen gegenüber der Kfz-Versicherung:
- Die Haftpflichtversicherung muss zwar zahlen – kann aber bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten bis zu 5.000 Euro Regress beim Fahrer geltend machen.
- Die Kaskoversicherung (Teil- oder Vollkasko) kann die Leistung komplett verweigern, wenn Alkohol als Schadensursache nachgewiesen wird.
- Zivilrechtliche Schadensersatzforderungen – z. B. bei verletzten Personen – treffen den Fahrer in voller Höhe, wenn der Versicherungsschutz entfällt.
Auch Mitfahrer, die zu Schaden kommen, können eigene Ansprüche gegen den alkoholisierten Fahrer geltend machen.
4. Berufliche und private Folgen
Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr hat häufig massive Auswirkungen auf das Berufsleben – weit über das eigentliche Strafmaß hinaus:
- Verlust des Arbeitsplatzes bei Fahrverpflichtung (z. B. Außendienst, Handwerk, ÖPNV)
- Disziplinarverfahren bei Beamten, Soldaten oder im öffentlichen Dienst
- Probleme bei beruflicher Zulassung (z. B. Taxiunternehmen, Fahrlehrer, Speditionswesen)
- Auswirkungen auf private Versicherungsverträge (Rückstufungen, Kündigung)
- Belastung familiärer Verhältnisse, wenn Mobilität eingeschränkt ist (z. B. bei Betreuungspflichten)
Selbst wenn kein Unfall vorliegt, führt der Verlust des Führerscheins bei vielen Betroffenen zu einem existenzbedrohenden Einschnitt.
5. Die besondere Gefahr von „Restalkohol“
Viele Beschuldigte geraten nicht nach einer Partyfahrt, sondern am Morgen danach in eine Verkehrskontrolle – mit überraschend hohen Promillewerten. Der sogenannte Restalkohol ist besonders gefährlich, weil der Fahrer subjektiv als nüchtern empfindet, objektiv aber deutlich über der gesetzlichen Grenze liegt.
Beispiel:
Wer bis 2 Uhr nachts getrunken hat, ist selbst um 8 Uhr morgens häufig noch nicht wieder im straßenverkehrstauglichen Zustand – insbesondere bei regelmäßigem oder starkem Konsum.
In solchen Fällen besteht oft keine böse Absicht, rechtlich aber dennoch eine klare Strafbarkeit.
6. Wie sollte man sich bei einer Kontrolle oder Vernehmung verhalten?
Wird man wegen Alkohol am Steuer kontrolliert oder erhält eine Vorladung, ist das Verhalten entscheidend für den weiteren Verlauf des Verfahrens.
Wichtig zu wissen:
- Sie sind nicht verpflichtet, zur Sache auszusagen – auch nicht gegenüber der Polizei.
- Nur Angaben zur Person sind verpflichtend (Name, Anschrift, Geburtsdatum etc.).
- Verweigern Sie freiwillige Atemalkoholtests – diese sind rechtlich nicht verpflichtend und können zur eigenen Belastung führen.
- Die Blutentnahme wird aber regelmäßig durchgesetzt. Wehren Sie sich nicht, widersprechen Sie aber der Blutentnahme
- Auch vermeintlich entlastende Aussagen („Ich fühlte mich noch fahrtüchtig“) können belastend interpretiert werden.
Daher gilt: Keine vorschnellen Angaben – zunächst Akteneinsicht durch einen Verteidiger.
Ein erfahrener Strafverteidiger kann prüfen, ob:
- die Beweislage rechtlich haltbar ist,
- Verfahrensfehler bei Kontrolle oder Blutentnahme vorliegen,
- eine strafmildernde Einlassung sinnvoll ist,
- sich die Entziehung der Fahrerlaubnis vermeiden lässt,
- das Verfahren durch Auflagen eingestellt werden kann.
Fazit
Alkoholfahrten sind kein Kavaliersdelikt. Bereits bei geringen Werten oder ohne Unfall droht ein Strafverfahren mit gravierenden Nebenfolgen. Besonders schwer wiegt der Verlust der Fahrerlaubnis und die versicherungsrechtlichen Konsequenzen – häufig mit deutlichen finanziellen und beruflichen Auswirkungen.
Wer beschuldigt wird, unter Alkohol ein Fahrzeug geführt zu haben, sollte keine Aussagen ohne rechtliche Beratung machen – und frühzeitig Verteidigungsmöglichkeiten prüfen lassen. Die Weichen für den Ausgang des Verfahrens werden nicht im Gerichtssaal, sondern oft schon bei der Kontrolle oder ersten Anhörung gestellt.
Hinweis: Dieser Rechtstipp dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Wer betroffen ist, sollte unverzüglich anwaltlichen Rat einholen.
Rechtsanwalt Giesen ist seit 20 Jahren im Verkehrsrecht und im Strafrecht tätig. Er hat in vielen 100 Fällen erfolgreich verteidigt und schlimme Folgen verhindern können.
In dringenden Fällen steht er Ihnen auch kurzfristig telefonisch für eine erste kostenlose Einschätzung zur Verfügung. In jedem Fall ist eine anwaltliche Beratung günstiger als die Folgen einer verunglückten Verteidigung.
Sprechen Sie mit uns, bevor sie mit Personen sprechen, die gegen sie ermitteln!