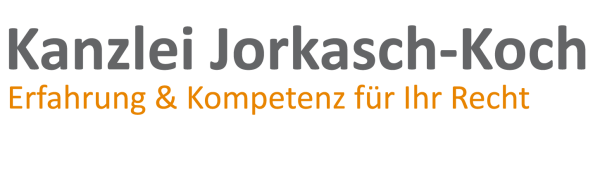In einem aktuellen Urteil hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) ein interessantes Urteil über die Anrechnung von Bereitschaftszeiten für Schulhausmeister getroffen. Das Bundesarbeitsgericht entschied kürzlich im Fall eines Schulhausmeisters, der seine Arbeitszeit und deren Vergütung infrage stellte. Das Urteil ist wichtig für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst, insbesondere für Hausmeister, die oft bereit stehen, um im Bedarfsfall ihre Arbeit aufzunehmen. Doch wieviel dieser Zeit gilt tatsächlich als Arbeitszeit? Hier ein Überblick über das Urteil.
Der Hintergrund: Wie wird Bereitschaftszeit gewertet?
Der Kläger, ein Schulhausmeister, war seit 1993 für die beklagte Stadt tätig. Er forderte eine vollständige Vergütung seiner gesamten Arbeitszeit, die regelmäßig auch Bereitschaftszeiten umfasste. Konkret ging es um die Vergütung von Februar bis Juli 2021. Die Arbeitgeberseite argumentierte, dass Bereitschaftszeiten nicht als volle Arbeitszeit zu bewerten sind. Diese müssten zur Hälfte als sogenannte "faktorisierte" Zeit gerechnet werden – eine Praxis, die auf dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) und dem Tarifvertrag Nordrhein-Westfalen (TVöD-NRW) basiert.
Nach den Regelungen des TVöD und TVöD-NRW sind Bereitschaftszeiten die Zeiten, in denen sich ein Hausmeister am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle bereithalten muss, um im Bedarfsfall Arbeiten aufzunehmen. Das bedeutet praktisch, dass der Hausmeister zwar anwesend und bereit ist zu arbeiten, aber nicht die gesamte Zeit aktiv arbeitet. Ein Beispiel wäre das Warten darauf, dass eine Schulveranstaltung endet, um anschließend die Räumlichkeiten zu schließen. Das Besondere ist, dass diese Bereitschaftszeiten zur Hälfte als Arbeitszeit gezählt werden.
Was wurde entschieden?
Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung klargestellt, dass die Revision des Klägers als unzulässig verworfen wird und die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf geändert wird. Die Berufung des Klägers wurde zurückgewiesen, und der Kläger muss die Kosten der Berufung und der Revision tragen.
Das Gericht stellte heraus, dass Bereitschaftszeiten für Schulhausmeister als typische Bestandteile ihrer Arbeit anzusehen sind. Diese Bereitschaftszeiten – wie zum Beispiel das Beaufsichtigen von Hilfskräften, der Ordnungsdienst oder die Bereitschaft zur Durchführung von Reparaturen – fallen regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang an. Sie sind von der Natur der Tätigkeit selbst geprägt. Aufgrund dieser Annahme müssen Schulhausmeister darlegen, dass die Zeiten mit Arbeitsleistung den größten Anteil an ihrer Zeit ausmachen, wenn sie eine volle Vergütung verlangen. Dies gelang dem Kläger im vorliegenden Fall nicht.
Eine Beweislastumkehr für Schulhausmeister
Das BAG hat auch deutlich gemacht, dass für Schulhausmeister eine sogenannte "Beweislastumkehr" gilt. Das bedeutet, dass der Hausmeister beweisen muss, dass die übliche Regel in seinem Fall nicht zutrifft. Es wird also grundsätzlich davon ausgegangen, dass Bereitschaftszeiten einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausmachen – und zwar durchschnittlich 25 % ihrer regulären Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer, also der Schulhausmeister, muss beweisen, dass diese Regel im konkreten Fall nicht zutrifft. Eine Ausnahme hiervon wäre nur dann anzunehmen, wenn der Hausmeister überwiegend voll gearbeitet hätte oder weniger Bereitschaftszeiten angefallen wären.
Das Gericht bestätigte, dass solche Zeiten der Bereitschaft auch nach heutiger Betrachtung für Schulhausmeister typisch sind – etwa durch geringere Auslastung in den Schulferien oder durch Tätigkeiten, die nicht durchgehend Arbeit erfordern, wie das Beaufsichtigen von Reinigungspersonal. Der Kläger konnte nicht darlegen, dass er während seiner gesamten Anwesenheitszeit tatsächlich Vollarbeit geleistet hatte. Daher war die Annahme der beklagten Stadt, dass Bereitschaftszeiten regelmäßig und in erheblichem Umfang anfallen, korrekt.
Die Relevanz für die Praxis
Dieses Urteil hat für viele Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst eine weitreichende Bedeutung. Insbesondere für Schulhausmeister und andere Tätigkeiten, bei denen Bereitschaftszeiten anfallen, bedeutet es, dass die Beweislast auf Seiten des Arbeitnehmers liegt, der eine volle Vergütung für seine Arbeitszeit beanspruchen will. Es reicht nicht aus, zu behaupten, dass man jederzeit vollständig gearbeitet hat – vielmehr müssen konkrete Aufzeichnungen vorgelegt werden, die den Umfang der Arbeit und der Bereitschaftszeit belegen.
Für Arbeitgeber bedeutet das Urteil, dass sie sich auf die tariflichen Vorgaben berufen können, um Bereitschaftszeiten zu faktorisieren. Dies kann zu einem erheblichen Unterschied in der Höhe der zu zahlenden Entgelte führen. Auch wurde klargestellt, dass der Arbeitgeber die Darlegungslast für über 25 % hinausgehende Bereitschaftszeiten trägt. Das heißt, wenn der Arbeitgeber der Meinung ist, dass Bereitschaftszeiten noch mehr als 25 % der gesamten Arbeitszeit ausmachen, muss er dies auch konkret belegen können.
Die Bedeutung der Arbeitszeiterfassung
Das Urteil des BAG bezieht sich auch auf die Frage der Arbeitszeiterfassung. Der Gerichtshof der Europäischen Union hatte 2019 eine Verpflichtung zur Einrichtung eines verlässlichen Systems zur Erfassung der geleisteten Arbeitszeit anerkannt. Allerdings stellte das BAG klar, dass diese Pflicht keine Änderung an der Beweislast im Rahmen von Überstundenvergütungsprozessen nach sich zieht. Das bedeutet, auch wenn ein Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter aufzuzeichnen, bleibt es dennoch Aufgabe des Arbeitnehmers, im Streitfall nachzuweisen, welche Teile seiner Arbeitszeit über die tariflich geregelte Normalarbeitszeit hinausgehen.
Fazit: Bereitschaftszeit bleibt Herausforderung
Das Urteil zeigt, wie schwer es für Arbeitnehmer sein kann, ihre Ansprüche auf vollständige Vergütung durchzusetzen, wenn Bereitschaftszeiten Teil ihrer Arbeit sind. Für viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst bleibt die Herausforderung bestehen, die eigene Arbeitsleistung detailliert zu dokumentieren, um im Falle eines Streits Ansprüche geltend machen zu können. Für Hausmeister bedeutet dies insbesondere, dass die besondere Natur ihrer Tätigkeit – die Kombination von Vollarbeit und Bereitschaftszeit – eine differenzierte Betrachtung erfordert.
Wenn ein Schulhausmeister also die Annahme widerlegen will, dass er regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftszeiten hat, sollte er sich genau auf diese Darlegungspflicht einstellen. Die Praxis zeigt, dass eine pauschale Aussage nicht reicht – es braucht konkrete Aufzeichnungen, die den tatsächlichen Arbeitsumfang belegen. Arbeitgeber sollten auf der anderen Seite sicherstellen, dass ihre Annahmen zur Arbeitszeit gut begründet und dokumentiert sind, um Konflikte zu vermeiden.
Dieses Urteil ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Details in Tarifverträgen und die spezifischen Gegebenheiten eines Arbeitsverhältnisses immer entscheidend sind – und wie wichtig eine gute Dokumentation und ein solides Verständnis der tariflichen Regelungen sind.