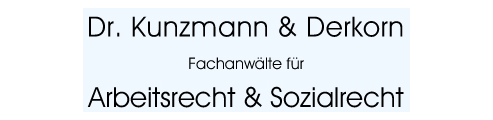Einleitung
Wie in jedem Jahr, in welchem die Fußballweltmeisterschaft der Herren stattfindet, werden auch im Jahr 2026 in Deutschland wieder die regelmäßigen Betriebsratswahlen stattfinden, und zwar in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai.
Im Jahr 2022 wurde in ca. 28.000 Betrieben eine neue Interessenvertretung gewählt, und damit nur noch in historisch niedrigen 7% aller Betriebe (im Jahr 1996 fanden sie noch in 49% aller Betriebe statt), und wahrscheinlich werden es bei der Wahl in 2026 noch ein paar weniger. Betroffen sind vor allem die Mitarbeiter in kleinen und mittleren Betrieben, die immer seltener auf die Unterstützung durch einen Betriebsrat zählen können. In Betrieben über 500 Mitarbeiter geht der Bestand an Betriebsräten weniger stark zurück. Zugleich ist auch die Tarifbindung rückläufig. Über die Gründe dieser Entwicklung will ich hier jetzt nicht spekulieren, bedenklich aber ist sie allemal.
Vielmehr will ich zur Vorbereitung der Wahl in loser Folge (und in eher unregelmäßigen Abständen) ein paar Texte zur Wahl bereitstellen, damit die Bildung einer Interessenvertretung nicht schon daran scheitert, dass man sich aus Angst vor Gesetzestexten und vor Fehlern bei der Durchführung erst gar nicht an die Wahl herantraut.
Ich selbst bin als Fachanwalt für Arbeitsrecht im Köln-Bonner Raum tätig und seit 2006 auch als Referent für das POKO-Institut, wo ich regelmäßig Schulungen für Betriebsräte halte – natürlich auch zum Thema BR-Wahl. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Wahlvorstände ich mittlerweile geschult habe, sicherlich an die Hundert.
Eine fehlerfreie Wahl ist selten
Meine Seminare beginne ich gerne mit einem wunderschönen Zitat aus einem Beschluss des LAG Thüringen vom 06.02.12 zum Aktenzeichen 1 TaBVGa 1/12:
„Es ist eine Illusion, anzunehmen, der komplexe Prozess einer kollektiven Willensbildung könne fehlerfrei ablaufen. … Erst recht bei Wahlen, selbst bei kleineren oder mittleren Betrieben, sind die Abläufe nicht zuletzt aufgrund einer komplizierten, heterogenen Zielen verpflichteten Wahlordnung derart verdichtet, dass ein idealtypischer Verlauf regelmäßig nicht erwartet werden kann.“
Mit etwas einfacheren Worten: Man kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Irgendein Fehler wird einem unterlaufen. Das Schöne: Sehr häufig fällt er bis zum Ablauf der Wahlanfechtungsfrist nicht einmal irgendjemandem auf.
Und selbst wenn: Viele Fehler wirken sich gar nicht aus oder sie sind den Beteiligten sogar egal, vor allem dann, wenn alle mit der Zusammensetzung des neuen Gremiums leben können. Arbeitgeber fechten viel seltener an als man glaubt, denn solch ein Verfahren ist teuer, und ein schlauer Arbeitgeber weiß, frei nach Sepp Herberger: nach dem Anfechtungsprozess ist vor der Wahl. Und dort, wo ein Betriebsrat insgesamt oder ganz bestimmte Arbeitnehmer als Mitglieder im BR unerwünscht sind oder eine unterlegene Fraktion ihre Niederlage nicht eingestehen will, wird die Wahl ohnehin schon aus Prinzip angefochten; da kann man sich noch so anstrengen, alles richtig zu machen.
Daher: nicht verzagen oder gar verzweifeln, sondern frisch ans Werk!
Rechtsquellen – notwendige Paragraphen – BetrVG und Wahlordnung
Wir brauchen auch gar nicht so viele Paragrafen. Rechtsquellen, die Vorschriften zur Betriebsratswahl enthalten, sind zum einen das Betriebsverfassungsgesetz, hier streng genommen die §§ 1 bis 21 (aber ein Blick darüber hinaus schadet jedenfalls nicht) sowie die Erste Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes, auch genannt Wahlordnung 2001 vom 11. Dezember 2001.
Das BetrVG enthält wichtige Rahmenregelungen wie die Frage, in welchen betrieblichen Einheiten überhaupt Betriebsräte gewählt werden können, wer Arbeitnehmer und wer leitender Angestellter ist, wer wahlberechtigt ist, wie viele Sitze der BR hat, welches Wahlverfahren (normales oder vereinfachtes) einzuhalten ist, wer die Wahlen leitet, die Anfechtung der Wahl und noch einiges mehr.
Die Wahlordnung 2001 (im Folgenden WO) hingegen enthält nähere (formelle) Regelungen zur Durchführung der in den §§ 1 bis 20 BetrVG enthaltenen Vorschriften über die Wahl des Betriebsrats (BR), zB. Aufgaben und Geschäftsführung des Wahlvorstands, Wählerverzeichnis, Wahlausschreiben, Form und Aufbau von Wahlvorschlägen und Stimmzetteln, den eigentlichen Ablauf der Wahl, wie die Stimmabgabe durchzuführen ist, wie sich die Sitzverteilung berechnet, was an Niederschriften zu fertigen und was alles bekannt zu machen ist.
Zu beobachten ist noch bis zum Beginn der Wahl, ob nicht noch Änderungen am BetrVG oder der WahlO vorgenommen werden. So ist in dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Tariftreuegesetz (Drucksache 20/14345 vom 20. Dezember 2024) geplant, in einem neu einzufügenden § 18b BetrVG die Möglichkeit einer Online-Stimmabgabe zu schaffen. Ob die neue Regierung dieses Vorhaben weiter verfolgt, bleibt abzuwarten. Ihr könnt ja spaßeshalber den Paragraphen einmal lesen und dann überlegen, ob die neue Regierung das Vorhaben überhaupt weiter verfolgen sollte.
Als erstes ist der amtierende BR gefragt!
Dass als erstes der amtierende BR gefragt ist, ergibt sich aus der Wahlordnung, und zwar aus § 1 WO. Denn nicht der amtierende BR führt die Wahl durch, sondern ein spezielles Gremium: Der Wahlvorstand.
Und es ist die wichtige Aufgabe des amtierenden BR, diesen Wahlvorstand ins Leben zu rufen oder, wie es im Gesetz heißt, zu bestellen. Hier werden bereits die Weichen gestellt für das Gelingen der Wahl.
Deshalb ist die Aufgabe, den Wahlvorstand zu bestellen, auch so bedeutsam und sollte vom amtierenden Betriebsrat gut vorbereitet sein, und das in verschiedener Hinsicht.
Wahlvorstand: zwingend notwendig – unabhängig – neutral
So regelt § 1 Abs. 1 WO: „Die Leitung der Wahl obliegt dem Wahlvorstand“. Das bedeutet dreierlei:
1. Jede Wahl eines Betriebsrats muss von einem Wahlvorstand durchgeführt werden.
Jede Betriebsratswahl setzt also die vorherige wirksame Bildung eines Wahlvorstands notwendig voraus.
Eine ohne Wahlvorstand durchgeführte Betriebsratswahl ist nach herrschender Meinung regelmäßig nichtig.
Nichtig wäre also zB. folgende Wahl: Der amtierende Betriebsrat beruft eine Betriebsversammlung ein. Nun führt er ohne vorherige Wahl eines Wahlvorstands an Ort und Stelle selbst die Wahl durch und fordert die Anwesenden auf, durch Handheben (Akklamation) die anwesenden Kandidaten in den BR zu wählen.
Eine Wahl wäre auch dann ohne Wahlvorstand durchgeführt und entsprechend nichtig, wenn bereits die Bestellung des Wahlvorstandes selbst nichtig wäre. Das ist aber nur in sehr seltenen Fällen gegeben:
LAG Hessen (Beschl. v. 14.09.2020, 16 TaBVGa 127/20): „Die Nichtigkeit der Bestellung eines Wahlvorstands für eine Betriebsratswahl ist auf ausgesprochen schwerwiegende Errichtungsfehler beschränkt, die dazu führen, dass das Gremium rechtlich inexistent ist. Dabei muss es sich um einen offensichtlichen und besonders groben Verstoß gegen die Bestellungsvorschriften der §§ 16 bis 17a BetrVG handeln.“
Die von einem fehlerhaft bestellten oder besetzten Wahlvorstand durchgeführte Betriebsratswahl wird in aller Regel nur anfechtbar sein, aber nicht nichtig.
Das LAG München (Beschluss vom 16.05.2017, 6 TaBV 108/16) schreibt: „Fehler bei der Bildung des Wahlvorstands begründen regelmäßig keine Nichtigkeit der nachfolgend durchgeführten Betriebsratswahl“.
Die Bestellung hat spätestens 10 Wochen vor Ablauf der Amtszeit des amtierenden Betriebsrats zu erfolgen.
Der amtierende Betriebsrat muss sich also informieren, welches die rechtlichen Voraussetzungen sind, formell wirksam den Wahlvorstand für die anstehende Wahl zu bestellen. Er muss sich über Fristen informieren, er ist es, der wissen muss, wann seine gerade laufende Amtszeit endet – die Erfahrung zeigt allerdings, dass nur die allerwenigsten Betriebsräte eine Ahnung davon haben, wann ihre eigene Amtszeit begann und wann sie enden wird.
2. Ausschließlich der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch.
Der WV ist ein eigenständiges und unabhängiges Organ. Er ist vom Arbeitgeber und der Geschäftsleitung, aber auch vom amtierenden Betriebsrat unabhängig, und das, obwohl der amtierende BR ihn selbst bestellt hat.
Der WV fasst eigene Beschlüsse und ist dabei auch in der rechtlichen Bewertung von Sachverhalten (Leitende Angestellte, Betriebsbegriff) nicht an die (bisherige) Einschätzung anderer Organe gebunden. Je nachdem muss er sich jedoch mit dem Wahlvorstand für die Wahl des Sprecherausschusses für die Leitenden Angestellten abstimmen, was den Status einzelner Arbeitnehmer angeht.
Der amtierende Betriebsrat kann den Wahlvorstand evtl. unterstützen, hat sich aber ansonsten jeder Einmischung zu enthalten; auch (und erst recht) die/der Betriebsrats-Vorsitzende ist nicht weisungsbefugt, selbst wenn sie/er Mitglied oder sogar Vorsitzende/r des Wahlvorstands sein sollte.
Der Betriebsrat ist vor allem nicht befugt, die von ihm eingesetzten Mitglieder des Wahlvorstands (gegen ihren Willen) wieder abzuberufen.
Der Wahlvorstand kann verlangen, dass jede Form der unzulässigen Einflussnahme unterlassen wird, egal von wem.
Der Wahlvorstand soll die ihm obliegenden Aufgaben ohne Einfluss von außen durchführen können; zu den Aufgaben gehören die Einleitung und Durchführung der Wahl und die Feststellung des Wahlergebnisses. Weiterhin muss er ganz allgemein darauf achten, dass die Wahl rechtmäßig und ordnungsgemäß durchgeführt wird.
Dazu hat er das Recht, sämtliche Störungen und Hindernisse, die der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl entgegenstehen – zur Not auch mit gerichtlicher Hilfe – zu beseitigen.
Der Wahlvorstand ist deshalb bei den Arbeitsgerichten beteiligungsfähig und auch antragsbefugt.
3. Gemäß § 1 Abs. 1 WO obliegt dem Wahlvorstand die „Leitung der Wahl“. Das bedeutet, dass er im Wesentlichen organisatorische Aufgaben hat (BAG, 15.05.2013, 7 ABR 40/11).
Daher ist der Wahlvorstand kein dem Arbeitsgericht vorgeschaltetes Wahlanfechtungs-Prüfungsorgan.
Zu seinen Aufgaben gehört zB. nicht die Prüfung, ob Wähler bei der Sammlung von Stützunterschriften für einen Wahlvorschlag getäuscht wurden oder ob eine unzulässige Einflussnahme auf die Wahl dadurch vorliegt, dass leitende Angestellte für eine Liste Stützunterschriften sammeln.
Es bedeutet aber auch, dass der WV die Wahl strikt nach Maßgabe der Wahlvorschriften durchzuführen und sich dabei neutral zu verhalten hat; er muss sicherstellen, dass alle Kandidaten und Listen die gleichen Chancen haben auf einen Wahlerfolg (vgl. zB. LAG Stuttgart, 27.11.2019, 4 TaBV 2/19).
BR trifft bedeutende Personalentscheidungen
Der amtierende Betriebsrat muss sich also Gedanken machen, welche (wahlberechtigten!) Personen in der Lage sind, das Amt des Wahlvorstands zu übernehmen.
Die Mitglieder des Wahlvorstands müssen sich nicht nur mit Rechtsvorschriften auseinandersetzen können, sondern sollten auch eine gewisse Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit mitbringen.
Es bedarf also nicht nur fachlicher, sondern auch persönlicher Qualifikationen für das Amt, zu der neben Unparteilichkeit auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Sorgfalt gehören ebenso wie organisatorisches Talent, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke; diese persönlichen Eigenschaften sollten insbesondere in der Person der oder des Wahlvorstandsvorsitzenden vorhanden sein.
Diese bedeutenden Personalentscheidungen darf der amtierende BR nicht leichtfertig und niemals aus den falschen Erwägungen heraus treffen, zB. nur um jemandem Kündigungsschutz zu verschaffen.
BR legt den Grundstein für eine erfolgreiche Wahl
Die Bestellung des Wahlvorstands zur Durchführung einer regelmäßigen Wahl (und nur um die geht es hier) erfolgt immer durch den amtierenden Betriebsrat, § 16 Abs. 1 BetrVG.
Durch eine ordnungsgemäße Einsetzung stellt er somit die Weichen für die erfolgreiche Organisation und letztlich auch Durchführung der Wahl. Er muss durch rechtzeitige Bestellung des WV dafür sorgen, dass die Wahl vor Ende seiner Amtszeit stattfindet und keine betriebsratslose Zeit eintritt, er legt die Anzahl WV-Mitglieder und Ersatzmitglieder fest und bestellt sie; einen davon macht er zur oder zum Vorsitzenden. Er muss vorher schon überlegen, wie viele Wahllokale unterhalten werden sollen; dies erfordert je nachdem auch eine Beschäftigung mit dem Betriebsbegriff und der Frage, welche möglicherweise verstreuten Teile des Unternehmens einen gemeinsamen Betriebsrat wählen.
Es ist deshalb äußerst wichtig, dass sich der BR rechtzeitig vor der Bestellung des WV selbst einmal intensiv mit dem Thema „Wahl“ beschäftigt, um hier für einen optimalen Start sorgen zu können.
Andere Gremien, die ausnahmsweise den WV bestellen
Bleibt der amtierende Betriebsrat aus irgendeinem Grund untätig, gilt folgendes: Wenn der amtierende Betriebsrat 8 Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit immer noch keinen Wahlvorstand bestellt hat, können drei Wahlberechtigte oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft beim Arbeitsgericht eine Bestellung beantragen, § 16 Abs. 2 BetrVG. Parallel dazu kann aber immer noch der amtierende Betriebsrat oder der GBR/KBR möglich, sofern diese Gremien existieren, den Wahlvorstand bestellen, vgl. hierzu § 16 Abs. 3 BetrVG.
Im nächsten Artikel erkläre ich dann, wie die Bestellung des Wahlvorstands durch den amtierenden Betriebsrat tatsächlich abläuft.