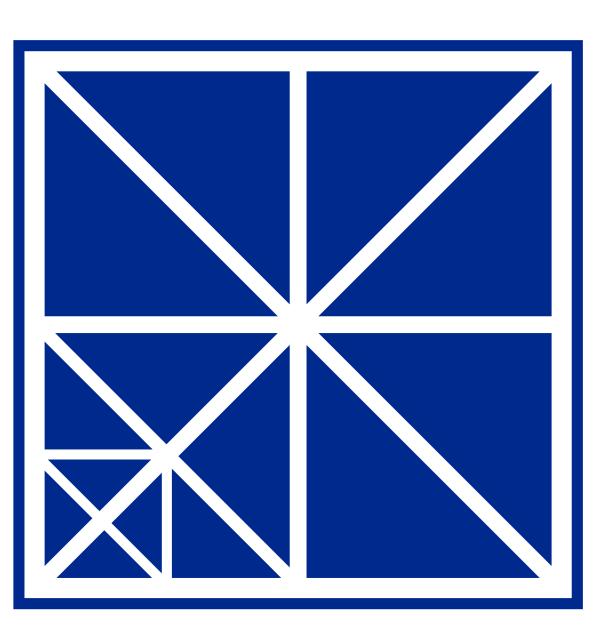Bei zahnärztlichen sowie tierärztlichen Arbeitgebern bestehen große Unsicherheiten hinsichtlich der Entscheidung des Arbeitgebers, ob eine sog. unverantwortbare Gefährdung von dem Arbeitsplatz einer stillenden Arbeitnehmerin ausgeht. Diese Entscheidung hat Einfluss darauf, ob die Mitarbeiterin trotz des Stillens ihre reguläre Arbeit wiederaufnehmen kann, der Arbeitsplatz umgestaltet werden muss oder in letzter Konsequenz ein Stillbeschäftigungsverbot auszusprechen ist.
Geschürt wird diese Unsicherheit durch ein Arbeitspapier sog. „Arbeitshilfe Gefährdungsbeurteilung Stillzeit“ eines Ad-hoc-Arbeitskreises Stillschutz aus Baden-Württemberg. Ausweislich dessen liege eine unverantwortbare Gefährdung lediglich dann vor, wenn mit Amalgam gearbeitet wird, sodass eine Weiterarbeit der stillenden Mutter problemlos möglich sei, sofern das Legen von Amalgam in ihrer Tätigkeit ausgeschlossen wird. Bis dieser Ad-hoc-Arbeitskreis tätig wurde, war die Rechtslage klar: Solange die Arbeitnehmerin ihr Kind stillt, darf sie die zahnärztlichen / tierärztlichen Tätigkeiten nicht vornehmen. Es war notwendigerweise ein Beschäftigungsverbot auszusprechen, welches sich auf den gesamten Zeitraum des Stillens erstreckt.
Das Empfehlungspapier des Ad-hoc-Arbeitskreises fußt auf der politischen Intention des Landes Baden-Württemberg mit dem Ziel, die finanziellen Risiken der Stillzeit auf die Privatwirtschaft zu verlagern. Das Ministerium hat es sich zum Ziel gemacht die Krankenkassen zu „entlasten“. Diese Entlastung muss jemand zahlen. Mit dem Ansinnen des Landes Baden-Württemberg, das StillBV abzuschaffen, wurden und werden viele Arbeitnehmerinnen zu Unrecht in die Elternzeit gedrängt. So wurde das wirtschaftliche Risiko auf die stillende Mutter bzw. vielmehr den zahnärztlichen Arbeitgeber verlagert, der im Zweifel die stillende Mutter in der Praxis irgendwie zu beschäftigen hat, sofern sie arbeiten kann und will. Die Urheber dieser Strategie gehen davon aus, dass die Zahnärztin aber vielmehr Elternzeit beantragt und dadurch deutlich weniger Geld vom Staat bezieht als beim Stillbeschäftigungsverbot oder stillend weiterarbeitet. In letzterem Fall müssen die Arbeitgeber anerkanntermaßen den Mutterschutzlohn in voller Höhe weiterzuzahlen, d.h. inklusive einer Umsatzbeteiligung – sofern vereinbart –, unabhängig von der Höhe des tatsächlich erzielten Umsatzes der Zahnärztin, was schlussendlich für viele zahnärztliche Arbeitgeber ein Ärgernis bedeutet. Der Arbeitgeber hingegen kann seine stillende Mitarbeiterin nur sehr eingeschränkt einsetzen und muss regelmäßige Stillpausen ermöglichen. Die stillende Mutter hat erheblichen Aufwand, die Stillzeit und die Arbeitszeitplanung unter einen Hut zu bekommen. Im Übrigen entstehen während des Beschäftigungsverbots Urlaubsansprüche der Arbeitnehmerin, welche nicht, auch nicht anteilig – wie bei der Elternzeit – gekürzt werden können. Die Kosten hierfür werden nicht von der U2-Umlage getragen, sondern verbleiben als finanzieller Schaden beim Arbeitgeber.
Die Intention des Landes Baden-Württemberg, dem StillBV den Kampf anzusagen, zeigt sich ganz deutlich daran, dass die Gefährdungsbeurteilung des Landes Baden-Württemberg ganz unten bei den „erforderlichen Maßnahmen“ gar kein Kästchen mehr vorsieht für den Ausspruch eines Stillbeschäftigungsverbots, obschon in einer Vielzahl von Fällen ein Beschäftigungsverbot unumgänglich ist. Dies zeigt – nach unserem Dafürhalten in sehr unseriöser Weise – wie sehr die zahnärztlichen Arbeitgeber dazu gedrängt werden, das StillBV abzulehnen.
Anders beurteilen die übrigen LZÄKn sowie die BZÄK die Thematik. Auch bei den Krankenkassen ist das Stillbeschäftigungsverbot völlig unproblematisch anerkannt.
Der Arbeitsschutz, worunter auch das Thema des Ausspruchs des StillBV zählt, ist Ländersache. Daher bestehen keine bundeseinheitlichen Richtlinien zum Arbeitsschutz. Nachdem nun Monate und Jahre unklar war, welche Vorgaben maßgeblich sind und ob die Arbeit einer Zahnärztin am Patienten überhaupt noch möglich sein soll, wurde durch das Arbeitsgericht Hagen nun eine nach unserem Dafürhalten längst überfällige und wegweisende Entscheidung getroffen, welche dem Ad-hoc-Arbeitskreis und den Vorgaben des Landes BaWü endlich eine klare Absage erteilte.
Das zugrunde liegende Urteil des Arbeitsgerichts Hagen vom 11.09.2024 – 2 Ga 22/24 erging in einem einstweiligen Verfügungsverfahren. Ein solches ist dadurch gekennzeichnet, dass der Verfügungskläger eine Eilbedürftigkeit glaubhaft machen muss, d.h. die Tatsachen vorbringen, weshalb es nicht zumutbar ist, ein Hauptsachverfahren abzuwarten. Die Verfahren zeichnen sich zudem dadurch aus, dass keine Beweisaufnahme durchgeführt wird und dass die Entscheidung des Gerichts anhand der vorgelegten Schriftsätze der Parteien ergeht.
In dem vorstehenden Urteil statuiert das Gericht, dass die Vorgaben und Richtlinien der Bundeszahnärztekammer einschlägig sind für die Beantwortung der Frage nach der unverantwortbaren Gefährdung und nicht etwa die des Landes Baden-Württemberg. So heißt es:
„Ausweislich der Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer von März 2022 (vgl. Bl. 15-23 der Akte) Seite 6 liegt das arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbedingte Infektionsrisiko einer stillenden Zahnärztin und ihres zu stillenden Kindes in der Zahnarztpraxis üblicher Weise über demjenigen der Allgemeinbevölkerung. Es bestehen auch verschiedene Übertragungswege von potentiellen Infektionen, die mit den Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen einer stillenden Zahnärztin in unmittelbaren Bezug stehen. Die typischerweise mit dem Beruf der Zahnärztin verbundenen Tätigkeiten in einer Zahnarztpraxis bedingen dabei nicht nur einen häufigeren Umgang mit Körperflüssigkeiten wie Blut oder Speichel. Die zahnärztliche Behandlung am Behandlungsstuhl erfordert auch einen engen Kontakt zu den Patientinnen und Patienten (weniger als 1,5m). Zudem verursachen zahnärztliche Tätigkeiten regelmäßig einen am Behandlungsstuhl messbar erhöhten Aerosolausstoß. Auch potentiell kontaminierte, zahnärztliche Instrumente beinhalten ein erhöhtes Infektionsrisiko für die stillende Zahnärztin. Dies nicht zuletzt, weil das zahnärztliche Instrumentarium dazu geeignet ist, Stich- oder Schnittverletzungen zu verursachen.“
Etwaige Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers, die sich darauf beziehen, dass die Zahnärztin Latex-Handschuhe oder eine FFP2-Schutzmaske tragen soll, um das Risiko der Übertragung von diversen Krankheitserregern zu verhindern, sind nach Auffassung der BZÄK in der Regel nicht geeignet, um die vorstehenden Risikofaktoren auszumerzen.
In den aktuell von uns verhandelten Fällen gehen alle Gerichte davon aus, dass jede Praxis eigenständig zu begutachten ist. Im Streitfall wird ein Gutachten durch einen Betriebsmediziner in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob die individuellen Gegebenheiten der einzelnen Praxis eine Weiterarbeit ermöglichen und respektive welche Maßnahmen im Sinne von § 13 Abs. 1 MuSchG getroffen werden müssen. Hierdurch entstehen zum Teil jahrelange Unsicherheiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmerin und im Zweifel stillt die Arbeitnehmerin ihr Kind in dem Zeitpunkt einer gerichtlichen Entscheidung gar nicht mehr.
Das Urteil des Arbeitsgerichts Hagen ist insofern wegweisend, als dass nun endlich Klarheit dahingehend herrscht, dass die Vorgaben der BZÄK maßgebend für die arbeitgeberseitige Entscheidung für den Ausspruch des StillBV sind, und zudem der Berücksichtigung des Empfehlungspapiers des Ad-hoc-Arbeitskreis – wenigstens abseits von Baden-Württemberg – eine Absage erteilt wurde. Wenn die Arbeitgeber sich darauf stützen, dass sie das StillBV aussprechen würden, es aber vor dem Hintergrund der Empfehlungen aus BaWü schlicht nicht könnten, ohne sich einem erheblichen Regressrisiko der Krankenkasse oder gar einer Strafbarkeit ausgesetzt zu sehen, kann ihnen künftig mit den Erwägungen aus dem Urteil begegnet werden. Zudem ist zu erwarten, dass sich andere Gerichte im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahren dem Arbeitsgericht Hagen anschließen und den Ausspruch des StillBV als obligatorisch ansehen.
Fazit:
Die Betrachtung des Einzelfalls bleibt weiterhin unerlässlich, da der Ausspruch des betrieblichen Stillbeschäftigungsverbots stets auf individuellen Gegebenheiten sowohl der Praxis als auch der stillenden Mutter beruht. Dies gilt sowohl für die tatsächlichen Grundlagen als auch die Beratung hinsichtlich der sich ergebenden rechtlichen Konsequenzen, zu denen wir Sie gerne beraten. Ein zügiges Vorgehen seitens der Arbeitnehmerin ist dringend erforderlich, insbesondere drohen Ausschlussfristen zu verstreichen oder der Verfügungsgrund verloren zu gehen.
Dr. Michael Heintz Julia Johannsmann
Rechtsanwalt Rechtsreferendarin
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht