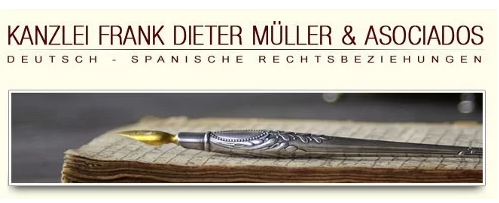In Spanien regelt das Zivilrecht – wie in jedem anderen Land auch – die rechtlichen Beziehungen zwischen gleichgestellten Personen, die grundsätzlich auf freiem Willen basieren. Das sogenannte Derecho Civil umfasst Bereiche wie das Bürgerliche Recht, welches durch das spanische Zivilgesetzbuch (Código Civil) sowie spezielle Gesetze zum Handels-, Arbeits-, Miet-, Familien-, Immobilien-, Bau-, Bank- und Versicherungsrecht bestimmt wird. Letztgenannte Gesetze finden sich im spanischen Gesetzblatt (Boletín Oficial del Estado). Ein wichtiger Teil des Zivilrechts ist beispielsweise das Vertragsrecht und das Kaufrecht, aber auch die Normen über andere vertragliche oder gesetzliche Rechtsverhältnisse zwischen Personen, Sachen bzw. Rechten.
Das spanische Zivilrecht hat seine Wurzeln im römischen Recht, das ab dem 2. Jahrhundert n. C. allgemein in der iberischen Halbinsel angewandt wurde. Trotz Einflüssen wie dem westgotischen, maurischen und kanonischen Recht, blieb das römische Recht die wichtigste Quelle. Das heutige Zivilgesetzbuch basiert auf dem französischen Zivilgesetzbuch von 1851 und trat 1889 in Kraft. Nach der Verfassung von 1978 wurden wichtige Reformen vorgenommen, etwa die Gleichstellung von Mann und Frau.
In Spanien gilt neben dem allgemeinen nationalen Recht für den gesamten Staat, zusätzlich in einigen der Autonomien spezifisches Foralrecht. So existieren beispielsweise in Katalonien spezielle Regelungen für das Güter- und Erbrecht, die von den allgemeinen spanischen Vorschriften abweichen. Die Gesetzgebungskompetenz für Normen über die Anwendung und Wirksamkeit von Rechtsvorschriften, Grundlagen vertraglicher Schuldverhältnisse und Kollisionsnormen liegt allein bei der Zentralregierung. In der Regel ist das einschlägige Recht abhängig von der Gebietszugehörigkeit des betroffenen Rechtssubjekts.
Bei Konflikten zwischen dem nationalen und regionalen Recht entscheidet das Verfassungsgericht.
Das Internationale Privatrecht (abgekürzt IPR) regelt, welches Recht bei grenzüberschreitenden Sachverhalten Anwendung findet. Es klärt, ob spanisches oder beispielsweise deutsches Recht zur Anwendung kommt. Relevante Normen sind im spanischen Zivilgesetzbuch (Art. 8 f CC, Código Civil, Zivilgesetzbuch Spanien) und im deutschen EGBGB enthalten. Internationale Verträge und das EU-Recht, insbesondere die Verordnungen Rom I, II und III, sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Im Rahmen der Parteiautonomie kann das anwendbare Recht grundsätzlich frei gewählt werden, was die Rom I-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 593/2008) seit 2009 für schuldrechtliche Verträge festlegt. Fehlt eine solche Wahl, richtet sich das anwendbare Recht nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Verkäufers oder Dienstleisters.
Spanische Gerichte prüfen ausländisches Recht nur, wenn es nachgewiesen wird, auch wenn sie grundsätzlich nach Art. 12 CC von Amts wegen das IPR prüfen müssen. Nach Art. 281 II der spanischen Zivilprozessordnung (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, LEC abgekürzt) muss das ausländische Recht im Verfahren bewiesen werden, andernfalls wird spanisches Recht angewandt. In der Praxis sind meist zwei von Rechtsanwälten unterzeichnete Rechtsgutachten erforderlich, um Geltung und Inhalt des ausländischen Rechts nachzuweisen.
Unsere Kanzlei verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung internationaler Mandanten und der Beachtung dieser Anforderungen in spanischen Gerichtsverfahren. Kontaktieren Sie uns gerne für eine unverbindliche Beratung oder einen Kostenvoranschlag.
bj