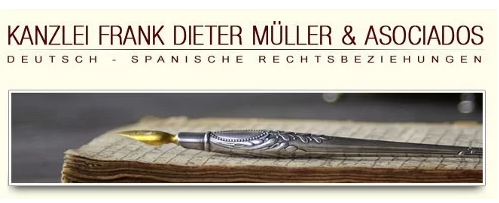Nach der seit 2015 geltenden EU-Erbrechtsverordnung sind grundsätzlich die Gerichte für die Rechtsnachfolge von Todes wegen zuständig, in denen der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann jedoch im Rahmen eines Testamentes oder Erbvertrages eine Gerichtsstandsvereinbarung zulässig sein.
Art. 20 ff. EU-ErbVO regeln das auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendende Recht: In vielen EU-Mitgliedsstaaten gilt das Staatsangehörigkeitsprinzip (so auch in Deutschland) im Erbrecht. Dies führt dazu, dass die Staatsangehörigkeit des Erblassers über das anzuwendende Recht entscheidet. Die EU-Erbrechtsverordnung ersetzt dieses Prinzip durch das des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes.
Es wird jedoch auch die Möglichkeit eröffnet, das Heimatrecht (also das Recht der eigenen Staatsangehörigkeit) durch formgültige Rechtswahl im Rahmen einer Verfügung von Todes wegen zu wählen.
Außerdem kann in Ausnahmefällen, wenn „offensichtlich“ ist, dass eine engere Verbindung zu einem anderen Staat besteht, das Recht des jeweiligen Staates zur Anwendung kommen.
Die sonstigen Bestimmungen der EU-Erbrechtsverordnung umfassen Vorschriften über die Zulässigkeit, die materielle Wirksamkeit und die Formgültigkeit von schriftlichen Verfügungen von Todes wegen, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen.
Außerdem wird durch Art. 62 ff. EU-ErbVO ein einheitlicher europäischer Nachweis über die Erbenstellung (Europäisches Nachlasszeugnis) eingeführt.
Auswirkungen der Verordnung für Deutsche mit gewöhnlichem Aufenthalt in Spanien
Durch die Einführung des Europäischen Nachlasszeugnisses findet eine klare Vereinfachung statt, da sowohl die Übersetzungen von Erbscheinen, als auch die bisher notwendige Überbeglaubigung der deutschen Erbscheine überflüssig werden.
Problematisch ist hingegen die Einführung des Prinzips des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes. Dadurch, dass in Spanien unterschiedliche erbrechtliche Regelungen in den einzelnen autonomen Gebieten gelten und Art. 36 EU-ErbVO der Verordnung vorschreibt, dass „interne Kollisionsvorschriften“ des jeweiligen Staates die „Gebietseinheit“ bestimmen, kann eine Verlagerung des gewöhnlichen Aufenthaltes u.U. zu einer Veränderung der Rechtsnachfolge führen (wenn beispielsweise durch einen Wohnsitzwechsel an die Costa Brava plötzlich katalanisches Foralerbrecht statt des nationalen spanischen Rechtes Anwendung findet), was durch die erheblichen Unterschiede ganz wesentliche Folgen mit sich bringen kann.
bj