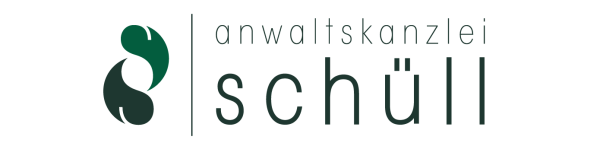Nach einem über 10 Jahre währenden Hin und Her zwischen den Mitgliedsstaaten hat sich die Europäische Union nun auf einen neuen Standard im Verbraucherrecht geeinigt und mit einer Abstimmung im Parlament den Mitgliedsstaaten eine Vorlage zur Umsetzung in nationales Recht geliefert. Die neue EU-Richtlinie befasst sich mit dem „Recht auf Reparatur“ und verlangt ab sofort, dass in den Handel kommende Elektro- und Elektronik-Geräte repariert werden müssen, wenn der Verbraucher diesen Wunsch hat. Bislang konnten Verkäufer dies ablehnen mit dem Hinweis auf die Kosten im Gegensatz zur Neuanschaffung.
„Und überhaupt: Das Recht auf Reparatur gab es bislang nicht“, so Rechtsanwalt Christoph Schüll, der sich auch als www.kuechenanwalt.de intensiv mit Verbraucherthemen rund um Garantie und Gewährleistung befasst,
Das neue Gesetz liegt als finales Normenwerk noch nicht vor, bzw. ist noch nicht veröffentlicht. Erst nach intensivem Studium wird man genau definieren können, was es mit dem Recht auf Reparatur auf sich hat, wo es beginnt und wo es endet, und vor allem was es für den Verbraucher in der Praxis bedeutet.
Betroffen sind auf jeden Fall folgende Warengruppen:
- Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner, (EU) 2019/2023
- Haushaltsgeschirrspüler, (EU) 2019/2022
- Kühlgeräte, (EU) 2019/2021
- Elektronische Displays (z. B. Monitore, Fernseher), (EU) 2019/2021
- Schweißgeräte, (EU) 2019/1784
- Staubsauger, (EU) No 666/2013
- Server und Datenspeicherprodukte, (EU) 2019/424
- Smartphones, Mobiltelefone, schnurlose Telefone, Tablets, (EU) 2023/1670
- Haushaltswäschetrockner, (EU) 2023/2533)
- Batterien für leichte Transportmittel, (EU) 2023/1542
Rechtsanwalt Schüll: „Es ist davon auszugehen, dass die EU vor allem Elektroschrott vermeiden und Geräte länger im Umlauf halten will. Dies dürfte besonders für Handys, Computer etc. gelten, wohl aber auch für normale Alltagsgegenstände aus dem Küchenbereich, so z.B. Kleingeräte wie Mixer oder Saftpressen, aber auch Weiße Ware wie z.B. Kühlschränke.“
Es ist wohl davon auszugehen, dass das Recht auf Reparatur im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflichten die bestehende Gesetzgebung erweitern wird. So wurde bekannt, dass sich die Gewährleistung für das reparierte Gerät um ein Jahr verlängert.
Schüll: „Im Grunde ist die EU-Richtlinie damit nur eine Erweiterung bestehender Gesetze mit einer Nachhaltigkeitskomponente. Was über Garantie und Gewährleistung hinaus noch wichtig wäre, ist der grundsätzliche Anspruch auf Reparaturmöglichkeiten!““ Beispiel: Elektrische Zahnbürsten und andere Kleingeräte arbeiten mit fest verbauten Akkus, bei einem Akkuschaden ist eine Reparatur nicht möglich. Laut www.kuechenanwalt.de wird die Vorschrift auch auf dieser Ebene greifen, wenn es von den Mitgliedsstaaten im nationalen Recht denn auch so gewollt sein wird. Entwickler und Hersteller werden sich bemühen müssen, wartungsfreundliche Geräte auf den Markt zu bringen.
Kann ein Gerät, das eigentlich noch gut funktionieren müsste, nicht repariert werden, dann sollte sich draus ein Kaufpreis-Erstattungsansprach oder die Ausgabe eines entsprechenden Neugeräts ergeben.
Ist ein Rasierer allerdings zu alt, wird das Recht auf Reparatur nicht mehr gelten. Es ist davon auszugehen, dass die Norm für Neugeräte, die nach Veröffentlichung der Richtlinie verkauft wurden, gelten wird.
Um all diese Details zu klären muss die EU-Richtlinie aber erst einmal vorliegen und dann bleibt noch abzuwarten, in welchem Umfang sie in deutsches Recht umgesetzt werden kann. Viel Spielraum haben die Mitgliedsstaaten nicht: Eine EU-Norm ist auch als Gesetz zu werten, wenn es noch in deutsches Recht überführt wurde. Bei einer Klage vor dem EU-Gerichtshofes wäre sie bindend.
Die EU selbst gibt aktuell eher vage Hinweise, die eher den Rahmen für eine zukünftige Handhabe schaffen.
- Hersteller müssen Produkte nach der gesetzlichen Gewährleistungszeit zu angemessenen Preisen und innerhalb angemessener Zeiträume reparieren
- Verbraucher müssen Zugang zu Ersatzteilen, Werkzeugen und Reparaturinformationen haben
- Reparaturanreize wie Gutscheine und Fördergelder für Reparaturen
- Online-Plattformen unterstützen bei Suche nach Reparaturbetrieben vor Ort und Verkäufern generalüberholter Geräte
Um das Reparieren zu erleichtern, wird eine europäische Online-Plattform mit nationalen Ablegern eingerichtet. Sie hilft, Reparaturbetriebe vor Ort, Verkäufer generalüberholter Geräte, Käufer defekter Geräte oder Reparaturinitiativen in der Nachbarschaft, z. B. Reparaturcafés, ausfindig zu machen..
Rechtsanwalt Schüll abschließend: „Ich gehe davon aus, dass das Recht auf Reparatur eher den normativen Rahmen für eine Wiederbelebung des Reparatur-Marktes schaffen soll und wird. Denn als Werkzeug des Verbraucherschutzes wird es sich eher mittelfristig etablieren, zumal wirklich unklar ist, welche Geräte in welchen Fristen von wem repariert werden sollen.
Das Recht auf Reparatur gilt natürlich – und das ist ein wesentlicher Faktor, auch über Garantie und Gewährleistung hinaus, auch wenn der Verbraucher die Kosten dann selbst zu tragen hat. Schüll: „Eigentlich ergibt sich erst dadurch die für den Verbraucher relevante Bedeutung der Richtlinie, denn Geräte müssen in Zukunft einfacher zu reparieren sein.“
Es bleibt spannend – zumindest bis zum Juni, denn wird die Richtlinie im EU-Amtsblatt veröffentlicht.