Fehlerhafte Knie-TEP: 110.000 Euro
Mit gerichtlichem Vergleich hat sich ein Krankenhaus verpflichtet, an meine Mandantin 110.000 Euro sowie meine außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren (2,0-Geschäftsgebühr) zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche meiner Mandantin zu zahlen. Das Krankenhaus hat sich auch verpflichtet, sämtliche Kosten des Rechtsstreites und des Vergleiches zu übernehmen.
Die 1971 geborene Angestellte erhielt wegen einer Valgusgonarthrose eine personalisierte Knietotalendoprothese in ihr linkes Kniegelenk eingesetzt. Direkt nach der Operation wies sie darauf hin, dass sie starke Schmerzen an der linken Kniescheibe und ihrem linken Schienbein hatte. Sie hatte starke Schmerzen beim Gehen, Treppensteigen, Tragen von Gegenständen, beim Duschen, beim Liegen, konnte keinen PKW mehr mit Schaltgetriebe fahren. Die Schmerzen wurden so stark, dass sieben Monate später ein Wechsel der Knie-TEP links durchgeführt werden musste. An den Schmerzen und Beschwerden änderte dieses nichts.
Erst Jahre später konnte die Mandantin wieder mit dem Radfahren beginnen, dieses nur mit einem speziellen Rad. Sie wacht nachts regelmäßig auf, weil sie Krämpfe im linken Bein bekommt. Bei der Reinigung ihrer Wohnung benötigt sie Hilfe. Bücken oder in die Hocke gehen sind nicht möglich. Wenn sie längere Zeit gesessen hat und dann aufsteht, hat sie stechende Schmerzen im linken Bein und im linken Knie.
Der gerichtliche Sachverständige hatte bestätigt: Da es sich bei der Knie-TEP um eine individuell angefertigte Prothese gehandelt habe, sei es nicht erklärlich, wie der Operateur beim Fräsen des Knochens trotz der angefertigten Sägeschiene die Prothese zu tief angebracht habe. Das habe dazu geführt, dass der Spielraum zwischen Oberschenkel und Unterschenkelknochen im Knie deutlich reduziert werde. Die Klägerin habe damit nicht mehr die volle Beugefähigkeit erlangen können. Der Operateur hätte sowohl visuell als auch taktil feststellen müssen, dass die Prothese zu weit nach hinten verlagert wurde. Eine Prüfung während der Operation sei nicht erfolgt. Es sei grob fehlerhaft, dass der Operateur nach dem erfolgen Sägen des Knochens nicht kontrolliert habe, welches Ergebnis er dadurch erzielt habe. Es hätte unbedingt eine Kontrolle stattfinden müssen, um zu sehen, ob die Komponenten auf dem Knochen passend seien. Hätte der Operateur diese Untersuchung durchgeführt, hätte er feststellen müssen, dass die vorhandene Prothese nicht auf dem Knochen aufgebracht werden konnte.
Spätestens postoperativ hätte eine Röntgenkontrolle stattfinden müssen. Sowohl intraoperativ als auch postoperativ hätte der Arzt festgestellt, dass ein Notching vorliege. Sowohl die Oberschenkel- als auch Unterschenkelkomponente sei fehlerhaft aufgebracht worden. Die Tibiakopfkomponente sei mit erhöhter Innenrotationsstellung eingebracht worden. Das sei unbedingt zu vermeiden. Dass sowohl Oberschenkel- als auch Unterschenkelknochen falsch gesägt worden seien, wäre schon speziell und komme nicht vor. Die gerügten groben Behandlungsfehler seien mit überwiegender Wahrscheinlichkeit kausal auf die aktuellen Beschwerden der Mandantin zurückzuführen.
Auch die Wechsel-OP habe nicht mehr für eine Besserung sorgen können, weil die Stellung des Knies nach der Wechsel-OP der sich angepassten Peripherie nicht mehr entspräche. Deshalb seien der vorhandene Belastungsschmerz und die aktuellen Probleme der Klägerin kausal auf diese ursprünglichen Behandlungsfehler in Form der Fehlstellung beider Knie-TEP-Komponenten zurückzuführen.
Das Gericht hat daraufhin den Hinweis erteilt, es halte ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 30.000 Euro für angemessen.
Der von mir berechnete Haushaltsführungsschaden in Höhe von 64.000 Euro sei ebenfalls zutreffend berechnet.
Um die Angelegenheit insgesamt abzuschließen, hat das Krankenhaus einen Betrag in Höhe von 110.000 Euro bei voller Kostenübernahme gezahlt.
(LG Krefeld, Vergleichsbeschluss vom 08.10.2024, AZ: 3 O 49/22)
Christian Koch, Fachanwalt für Medizinrecht & Verkehrsrecht
Mit gerichtlichem Vergleich hat sich ein Krankenhaus verpflichtet, an meine Mandantin 110.000 Euro sowie meine außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren (2,0-Geschäftsgebühr) zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche meiner Mandantin zu zahlen. Das Krankenhaus hat sich auch verpflichtet, sämtliche Kosten des Rechtsstreites und des Vergleiches zu übernehmen.
Die 1971 geborene Angestellte erhielt wegen einer Valgusgonarthrose eine personalisierte Knietotalendoprothese in ihr linkes Kniegelenk eingesetzt. Direkt nach der Operation wies sie darauf hin, dass sie starke Schmerzen an der linken Kniescheibe und ihrem linken Schienbein hatte. Sie hatte starke Schmerzen beim Gehen, Treppensteigen, Tragen von Gegenständen, beim Duschen, beim Liegen, konnte keinen PKW mehr mit Schaltgetriebe fahren. Die Schmerzen wurden so stark, dass sieben Monate später ein Wechsel der Knie-TEP links durchgeführt werden musste. An den Schmerzen und Beschwerden änderte dieses nichts.
Erst Jahre später konnte die Mandantin wieder mit dem Radfahren beginnen, dieses nur mit einem speziellen Rad. Sie wacht nachts regelmäßig auf, weil sie Krämpfe im linken Bein bekommt. Bei der Reinigung ihrer Wohnung benötigt sie Hilfe. Bücken oder in die Hocke gehen sind nicht möglich. Wenn sie längere Zeit gesessen hat und dann aufsteht, hat sie stechende Schmerzen im linken Bein und im linken Knie.
Der gerichtliche Sachverständige hatte bestätigt: Da es sich bei der Knie-TEP um eine individuell angefertigte Prothese gehandelt habe, sei es nicht erklärlich, wie der Operateur beim Fräsen des Knochens trotz der angefertigten Sägeschiene die Prothese zu tief angebracht habe. Das habe dazu geführt, dass der Spielraum zwischen Oberschenkel und Unterschenkelknochen im Knie deutlich reduziert werde. Die Klägerin habe damit nicht mehr die volle Beugefähigkeit erlangen können. Der Operateur hätte sowohl visuell als auch taktil feststellen müssen, dass die Prothese zu weit nach hinten verlagert wurde. Eine Prüfung während der Operation sei nicht erfolgt. Es sei grob fehlerhaft, dass der Operateur nach dem erfolgen Sägen des Knochens nicht kontrolliert habe, welches Ergebnis er dadurch erzielt habe. Es hätte unbedingt eine Kontrolle stattfinden müssen, um zu sehen, ob die Komponenten auf dem Knochen passend seien. Hätte der Operateur diese Untersuchung durchgeführt, hätte er feststellen müssen, dass die vorhandene Prothese nicht auf dem Knochen aufgebracht werden konnte.
Spätestens postoperativ hätte eine Röntgenkontrolle stattfinden müssen. Sowohl intraoperativ als auch postoperativ hätte der Arzt festgestellt, dass ein Notching vorliege. Sowohl die Oberschenkel- als auch Unterschenkelkomponente sei fehlerhaft aufgebracht worden. Die Tibiakopfkomponente sei mit erhöhter Innenrotationsstellung eingebracht worden. Das sei unbedingt zu vermeiden. Dass sowohl Oberschenkel- als auch Unterschenkelknochen falsch gesägt worden seien, wäre schon speziell und komme nicht vor. Die gerügten groben Behandlungsfehler seien mit überwiegender Wahrscheinlichkeit kausal auf die aktuellen Beschwerden der Mandantin zurückzuführen.
Auch die Wechsel-OP habe nicht mehr für eine Besserung sorgen können, weil die Stellung des Knies nach der Wechsel-OP der sich angepassten Peripherie nicht mehr entspräche. Deshalb seien der vorhandene Belastungsschmerz und die aktuellen Probleme der Klägerin kausal auf diese ursprünglichen Behandlungsfehler in Form der Fehlstellung beider Knie-TEP-Komponenten zurückzuführen.
Das Gericht hat daraufhin den Hinweis erteilt, es halte ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 30.000 Euro für angemessen.
Der von mir berechnete Haushaltsführungsschaden in Höhe von 64.000 Euro sei ebenfalls zutreffend berechnet.
Um die Angelegenheit insgesamt abzuschließen, hat das Krankenhaus einen Betrag in Höhe von 110.000 Euro bei voller Kostenübernahme gezahlt.
(LG Krefeld, Vergleichsbeschluss vom 08.10.2024, AZ: 3 O 49/22)
Christian Koch, Fachanwalt für Medizinrecht & Verkehrsrecht
Eine Organisation, der Sie vertrauen können
Fehlerhafte Knie-TEP: 110.000 Euro
2024/11/18

Christian Koch
4.94
•
100 Bewertungen
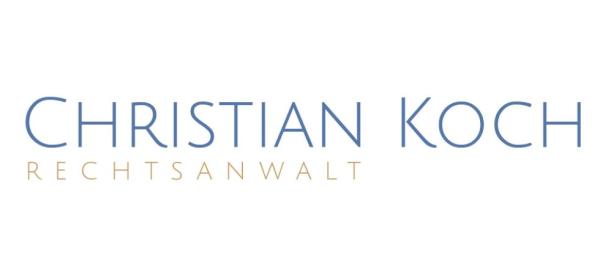
Kanzlei Christian Koch
5.00
•
1 Bewertungen
Artikel des Autors
-
1Fehlerhafte Brust-OP: 37.976,44 Eurovor 1 Monat
-
2Fehlerhafter Magen-Bypass: 90.000 Eurovor 3 Monaten
-
3Brustkrebs nicht erkannt: 25.000 Eurovor 4 Monaten
-
4Fraktur Oberschenkel: 33.500 Eurovor 4 Monaten
-
5Phlegmone durch Katzenbiss: 8.000 Eurovor 6 Monaten
-
6Kurzdarmsyndrom nach OP: 200.000 Eurovor 7 Monaten