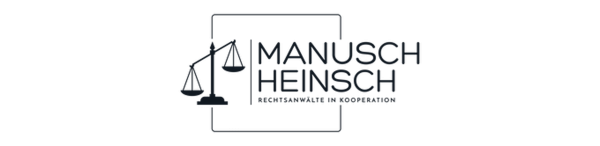Spätestens nach der Gesetzesänderung zur doppelten Staatsbürgerschaft und der Absenkung der Anforderungen in 2024 ist die Anzahl der Anträge auf Einbürgerung zur deutschen Staatsbürgerschaft erheblich geschwiegen.
Bereits zuvor haben die Anträge lange Zeit bei den hiesigen Regierungspräsidien in Anspruch genommen. Wenngleich es anfangs bis zu sechs Monaten gedauert hat, wird gegenwärtig oftmals die Jahresmarke ohne Mühe geknackt.
Viele Antragsteller fragen sich: kann ein Anwalt den Prozess beschleunigen?
Im Internet wird oftmals mit der Untätigkeitsklage als Allheilmittel geworben.
Der die Klageart begründende § 75 VwGO drückt in etwa aus, dass die Behörde ein Verwaltungshandeln innerhalb von drei Monaten vornehmen muss, sofern nicht gewichtige Gründe ein Überschreiten der Frist erlauben.
Nunmehr könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Prüfung und Erteilung bei der Einbürgerung ein solches Verwaltungshandeln darstellt und schnell vonstatten gehen muss. Mithin gehen die Gerichte in der letzten Zeit jedoch nicht davon aus.
So stellt der 3. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshof mit dem Beschluss 3 B 1062/24 vom 20.08.2024 fest, dass bereits aus der Komplexität des mehrstufigen Einbürgerungsverfahrens sich ergibt, dass eine Bearbeitungsfrist von drei Monaten weder dem Prüfungsaufwand noch den vielfältigen Beteiligungserfordernissen gerecht wird. "Denn die Prüfung eines Antrags auf Einbürgerung erfordert regelmäßig ein umfangreiches Verwaltungshandeln der Einbürgerungsbehörden unter notwendiger Mitwirkung einer Reihe weiterer Behörden. Gewichtige sicherheitsrechtliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gebieten zudem eine sorgfältige Überprüfung der identitätsrelevanten Personalien mit dem Ziel einer Richtigkeitsgewähr."
Dies in Verbindung mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, aufgrund welcher z.B. im RP Darmstadt eine Vielzahl von Mitarbeitern der Einbürgerungsdezernate an die IfSG-Projektgruppe abgeordnet waren, als auch mit den erheblichen Neuanträgen aufgrund benannter Gesetzesänderung als auch den Spätwirkungen der ersten Flüchtlingswellen vor gut 10 Jahren, mag eine weitere Verlängerung der Bearbeitungszeit begründen und rechtfertigen (vgl. VG Frankfurt am Main, Beschluss vom 25.09.2024, Az. 1 K 4045-23.F, VG Darmstadt, Beschluss vom 26.09.2024, Az. 5 K 2723-23.DA).
So heißt es konkret beim VG Frankfurt am Main:
"Die unterbliebene Bescheidung des Einbürgerungsantrages im Zeitpunkt der Erhebung der Untätigkeitsklage beruhte aber auf einem zureichenden Grund im Sinne des § 75 Satz 1 VwGO.
Ein Grund kann nur dann „zureichend" im Sinne des § 161 Abs. 3 VwGO sein, wenn ermit der Rechtsordnung in Einklang steht und im Licht der Wertentscheidungen des Grund-gesetzes, vor allem der Grundrechte, als zureichend angesehen werden kann (vgl.BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Januar 2017- 1 BvR 2406/16 -, juris;BVerwG, Beschluss vom 23. Juli 1991 - 3 C 56/90 -, juris).
Die Überlastung der Behörde durch eine "vorübergehende Antragsflut", beispielsweise infolge einer Gesetzesänderung, wird als zureichender Grund anerkannt, solange die Überlastung nicht von längerer Dauer ist und somit ein strukturelles Organisationsdefizit vorliegt (vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Januar 2017 - 1 BvR 2406/16 - , juris).
Auch "organisierte Massenanträge" können zu einer vorübergehenden Überlastung einer Behörde führen, ohnedass hieraus ein strukturelles Organisationsdefizit folgt (vgl. BVerfG, Nichtannahmebe-schluss vom 16. Januar 2017 - 1 BvR 2406/16 -, juris).
Bei der Prüfung, welche Entscheidungsfrist als angemessen gilt im Sinne des § 75 Satz 1VwGO, ist abzustellen auf die Zeit ab der Kenntnis der für die Sachentscheidung zuständigen Einbürgerungsbehörde von dem Einbürgerungsantrag bis zur Bescheidung desEinbürgerungsantrags.
Nicht zu berücksichtigen ist die Zeit, in der die untere Verwaltungsbehörde mit dem Antrag befasst ist, da die Einbürgerungsbehörde diese Bearbeiungszeit nicht zu verantworten hat und mangels Kenntnis von dem Einbürgerungsantragnoch keine Sachentscheidung treffen kann (vgl. hierzu auch VG Gießen, Beschluss vom30. April 2024 - 10 K 874/24.Gl -, nicht veröffentlicht).
Ebenfalls keine Berücksichtigung findet die Zeit von der Ausfertigung der Einbürgerungsurkunde bis zur Aushändigung derselben, da auch diese Zeitspanne nicht in den Verantwortungsbereich der Einbürgerungsbehörde fällt und der Entscheidung über den Einbürgerungsantrag nachgeht.
Bei der Bemessung der angemessenen Bearbeitungsfrist ist davon auszugehen, dass die 3-Monats-Frist des § 75 Satz 2 VwGO in der Regel nicht zureichend erscheint für eine Sachentscheidung im Einbürgerungsverfahren. Denn die Prüfung eines Antrags auf Einbürgerung erfordert in der Regel ein umfangreiches Verwaltungshandeln der Einbürgerungsbehörde unter notwendiger Beteiligung einer Reihe weiterer Behörden (so auch VG Gießen, das eine allgemeine Bearbeitungszeit von 9 Monaten für angemessen erachtet, vgl. Beschluss vom 30. April 2024 - 10 K 874/24.Gl -, nicht veröffentlicht; VG Wiesbaden,Beschluss vom 6. März 2024 - 6 K 1872/23. Wl -, nicht veröffentlicht). Gewichtige sicherheitsrechtliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gebieten eine sorgfältige Überprüfung der identitätsrelevanten Personalien mit dem Ziel einer Richtigkeitsgewähr(BVerwG, Urteil vom 1. September 2011 - 5 C 27/10 -, BVerwGE 140, 311-319; VG Gießen, Beschluss vom 30. April 2024 - 10 K 874/24.Gl -, nicht veröffentlicht). ...
Zu Recht beruft sich der Beklagte aber auf das Vorliegen zureichender Gründe, die eine darüber hinausgehende Entscheidungsfrist rechtfertigen. Wie dem Gericht auch aus anderen Einbürgerungsverfahren bekannt ist, besteht derzeit eine außergewöhnliche, unerwartete Überlastungssituation des Beklagten, die als vorübergehend und unvermeidbar anzusehen ist. Die Überlastung ist teilweise auf personelle Engpässe zurückzuführen, teilweise liegt der Grund in der deutlichen Zunahme von Einbürgerungsverfahren...
Erst infolge der Rückkehr dieser Mitarbeiterzum Jahresbeginn 2023 konnte sich der Beklagte wieder mit der vollen Arbeitskraft seinerBediensteten der Bearbeitung der zwischenzeitlich angefallenen Einbürgerungsanträgewidmen. Ebenfalls in dieser Zeit begann eine deutliche Zunahme der Antragsverfahren. Während im Jahr 2020 noch rund 12.000 Personen Einbürgerungsanträge stellten, ware nim Jahr 2023 knapp 22.000 Anträge zu verzeichnen, also nahezu eine Verdoppelung der Anträge. Ferner ist zu bemerken, dass zuletzt in nicht unerheblicher Anzahl und losgelöst vom Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen "organisierte Massenanträge" zu entscheiden sind, die regelmäßig in ebenfalls organisierte, rein aus formalen Gründen erhobene Untätigkeitsklagen münden...
Es ist nicht realistisch und kann nicht erwartet werden, dass sämtliche Rückstände in kürzester Zeit abgebaut werden. Hinzu kommt, dass am 27. Juni 2024 das neue Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft getreten ist. Insbesondere die Verkürzung der erforderlichen Aufenthaltszeiten und die Möglichkeit der Mehrstaatigkeit dürfte nach allgemeiner Auffassungabermals eine deutliche Steigerung der Antragszahlen nach sich ziehen. Es ist offensichtlich, dass eine weitere Aufstockung des Personals nicht ad hoc und ohne weiteres möglich ist in Zeiten des Fachkräftemangels, einer Vielzahl von Ruhestandseintritten und zwingend nötigen Haushaltseinsparungen (so im Kern auch VG Wiesbaden, Beschlussvom 6. März 2024 - 6 K 1872/23. Wl -, nicht veröffentlicht)...
Die allgemeinen Vorteile einer Einbürgerung, die jeder Person zuteil werden, die eingebürgert wird, reichen nicht aus, um eine Abweichung von der regulären Bearbeitungsreihenfolge zu rechtfertigen (so auchOVG Saarland, Beschluss vom 2. November 2023 - 2 E 123/23 -, juris). Es bestand damit kein Anlass, den Einbürgerungsantrag der Kläger vorzuziehen. Dass die Bearbeitung der Einbürgerungsanträge aus Gründen der Gleichbehandlung grundsätzlich in der Reihenfolge des Antragseingangs erfolgen, ist rechtlich nicht zu beanstanden (BVerfG,Beschluss vom 6. Februar 1995 - 1 BvR 54/94 -, juris). Der zureichende Grund für die verzögerte Bescheidung war den Klägern schließlich auch bekannt. Nach Eingang des Einbürgerungsantrags bei dem Beklagten wurden die Klägermit Schreiben vom 20. September 2023 über die derzeit verlängerte Bearbeitungszeit informiert. Zudem ist auf der Internetseite des Beklagten der Hinweis auf Verzögerungenbei der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen aufgeführt. Die Kläger mussten damiterkennen, dass eine abschließende Entscheidung über ihren Einbürgerungsantrag nichtinnerhalb der Frist des § 75 Satz 2 VwGO möglich ist. Sie waren nicht einem Zustand derUngewissheit ausgesetzt (vgl. hierzu auch BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Ja-nuar 2017 - 1 BvR 2406/16 -, juris).
Mithin lässt sich darauf schließen, dass eine Bearbeitungszeit von über einem Jahr grundsätzlich angemessen sein und dies sich sogar noch wesentlich verlängern kann nach den individuellen Umständen der Behörde.
Interessant ist insbesondere auch der Schwenk des Gerichts, dass die bereits angesprochen Internetangebote zur Pass-Beantragung als "organisierte Massenanträge" zu einer Verschlechterung der Antragssituation und der Wartezeit zulasten der Berechtigten führt.
Mithin ist je nach Dauer und Einzelfall eine Untätigkeitsklage immer mit einem gewissen, wenn nicht sogar hohen Prozessrisiko verbunden. Insoweit sollten Sie vorsichtig sein mit pauschalen Versprechungen im Internet! Lassen Sie sich stets vorher beraten und Ihren Einzelfall prüfen. Mögliche Härtefallregelungen kommen in Betracht.
*Der Artikel umfasst den Sachstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Grundsätzlich ist es immer möglich, dass je nach Einzelfall anderslautende Rechtsprechung ergangen ist, die teils auch nicht veröffentlicht wurde.