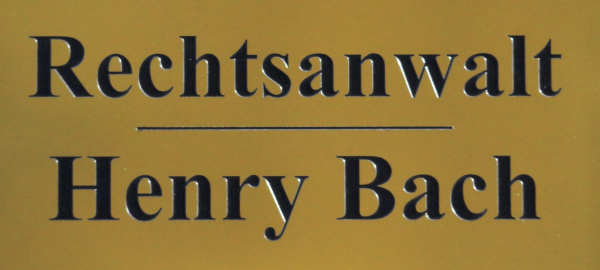Gem. § 558 Abs. 1 Satz 1 BGB ist der Vermieter berechtigt, eine Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete zu verlangen. Die Mieterhöhung kann erfolgen, wenn die Miete 15 Monate unverändert geblieben ist.
Die ortsübliche Vergleichsmiete wird im Mietrecht aus den üblichen Mieten gebildet, die in der Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Lage, Beschaffenheit und energetischer Ausstattung in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert wurden.
In den Mietspiegel dürfen solche Mieten nicht einfließen, die nicht im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekommen sind und Mieten, die unüblich niedrig oder hoch sind. Weiterhin darf kein Wohnraum berücksichtigt werden, bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt wurde.
Die ortsübliche Vergleichsmiete wird somit aus dem Durchschnitt aller Mieten für vergleichbaren Wohnraum gebildet, die zum Zeitpunkt des Zugangs des Mieterhöhungsverlangens in der Gemeinde entrichtet werden.
1. Wohnwertmerkmale des Mietspiegels
Die ortsübliche Vergleichsmiete ist anhand der folgenden Wohnwertmerkmale zu bestimmen:
a) Art
Damit wird die Art des Hauses oder der Wohnung bezeichnet. Es ist also zwischen Altbau oder Neubau, Einfamilienhaus, Reihenhaus oder Mehrfamilienhaus, Appartement oder Mehrzimmerwohnung zu unterscheiden.
b) Größe
Die Größe der Wohnung hat einen Einfluss auf die Quadratmetermiete. Die pro Quadratmeter gezahlte Miete ist bei kleineren Wohnungen höher als bei einer durchschnittlich großen Wohnung. Bei großen Wohnungen ist die Quadratmetermiete dagegen niedriger als bei einer durchschnittlich großen Wohnung.
c) Ausstattung
Die Ausstattung der Wohnung ergibt sich daraus, was der Vermieter dem Mieter zur Verfügung stellt. Hier kann es sich z.B. um Kellerräume, Speicher, Wandschränke, Badezimmereinrichtungen, Heizungen oder Bodenbeläge handeln.
d) Beschaffenheit
Die Beschaffenheit der Wohnung bezeichnet die Art und Gestaltung der Umgebung, die Bauweise und den Instandhaltungsgrad.
e) Lage
Mit der Lage wird die Lage des Hauses bezeichnet. Sie richtet sich danach, ob es sich bei dem Stadtteil um eine gute oder schlechte Wohnlage handelt. Die Ortslage wird ferner bestimmt durch die Baudichte, den baulichen Zustand des Stadtteils, ob Frei- und Grünflächen vorhanden sind, sowie durch Beeinträchtigungen durch Lärm, Geruch und Verkehr. Die Lage bezeichnet aber auch die Lage des Hauses, also ob es sich um ein Vorderhaus oder Hinterhaus handelt und welche Geschosslage vorhanden ist.
2. Begründungsmittel des Mieterhöhungsverlangens
Zur Begründung des Mieterhöhungsverlangens kann sich der Vermieter auf einen Mietspiegel, eine Auskunft aus einer Mieterdatenbank, ein Sachverständigengutachten oder auf drei Vergleichswohnungen beziehen (§ 558a Abs. 2 BGB).
a) Der einfache Mietspiegel
Der einfache Mietspiegel ist lediglich eine statistisch aufbereitete Sammlung von Vergleichsmieten. Es ist ausreichend, wenn er zwischen einem Vermieterverband und einem Mieterverband ausgehandelt wurde. Er kann vor Gericht im Rahmen der freien Beweiswürdigung zur Feststellung der ortsüblichen Miete herangezogen werden (BGH, Urteil vom 13.02.2019, Az. VIII ZR 245/17).
b) Der qualifizierte Mietspiegel
Ein qualifizierter Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder von den Interessenverbänden der Vermieter und Mieter anerkannt.
Bei einem qualifizierten Mietspiegel wird vermutet, dass dieser tatsächlich den ortsüblichen Mietzins wiedergibt. Bei einem qualifizierten Mietspiegel ist das Gericht berechtigt, die ortsübliche Miete allein anhand des Mietspiegels festzustellen. Es bedarf keines Sachverständigengutachtens mehr (BGH, Urteil vom 06.11.2013, Az. VIII ZR 346/12).
3. Formalien der Mieterhöhungserklärung
Die Miete darf innerhalb von drei Jahren um höchstens 20 % ansteigen.
Zudem ist es in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt möglich, eine Kappungsgrenze festzulegen. In Gebieten mit einer Kappungsgrenzenverordnung, darf die Miete in drei Jahren lediglich um 15 % steigen.
Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden.
Die Begründung muss in Textform erfolgen. Der Vermieter muss den Mietspiegel der Mieterhöhungserklärung nicht beifügen, wenn dieser öffentlich zugänglich ist. Das ist der Fall, wenn die Veröffentlichung des Mietspiegels im Amtsblatt erfolgt ist. Der Mietspiegel ist auch dann noch öffentlich zugänglich, wenn er gegen eine geringe Schutzgebühr von 3,- Euro erhältlich ist. Ist der Mietspiegel im Internet zu finden, ist dieser ebenfalls öffentlich, so dass er einer Mieterhöhungserklärung nicht beigefügt werden muss (BGH, Beschluss vom 28.04.2009 Az. VIII ZB 7/08).