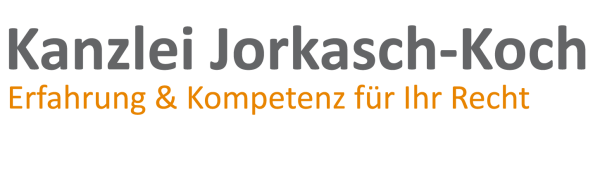In einem viel beachteten Urteil vom 21. August 2024 entschied das Bundesarbeitsgericht (5 AZR 266/23) über die Vergütung von Ruhepausen im Dreischichtbetrieb. Dabei ging es insbesondere um die Frage, ob Pausenzeiten, die durch betriebliche Anforderungen flexibel festgelegt werden, vergütet werden müssen.
Der Fall im Überblick
Der Kläger, seit 1988 bei der Beklagten beschäftigt, arbeitete in einem Dreischichtsystem in der Produktion eines Unternehmens der Feinstblechpackungsindustrie. Er forderte eine Vergütung für die Ruhepausen, die er während seiner Arbeit im Zeitraum von Juli bis Dezember 2021 genommen hatte. Die Kernfrage war, ob und unter welchen Bedingungen die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen im Dreischichtbetrieb als Arbeitszeit gelten und damit vergütet werden müssen.
Der Kläger berief sich dabei auf § 5 Nr. 5.5.7 des Gemeinsamen Manteltarifvertrags (GMTV), der besagt, dass „die regelmäßige Arbeitszeit, die durch die gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause entfällt, bezahlt wird“. Er argumentierte, dass der Zweck der Ruhepause durch die Anforderungen im Betrieb untergraben wurde, da er sich in „Daueralarmbereitschaft“ befunden habe. In der Kantine gab es einen Monitor, der Störungen an Maschinen anzeigte, was dem Kläger das Gefühl einer ständigen Bereitschaft vermittelte.
Entscheidung des Gerichts
Das Bundesarbeitsgericht wies die Revision des Klägers zurück und urteilte, dass die Voraussetzungen für eine Vergütung der Pausenzeiten in diesem speziellen Fall nicht erfüllt waren.
1. Tarifliche Grundlage – Keine Entlohnung ohne „Entfallen der Arbeitszeit“
Nach Auffassung des Gerichts ergibt sich aus dem Wortlaut des Tarifvertrags eindeutig, dass eine Vergütung nur dann vorgesehen ist, wenn durch die Pausen regelmäßige Arbeitszeit entfällt. Im Fall des Klägers war dies nicht gegeben, da er im Dreischichtbetrieb durchgängig die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit ohne Pausen geleistet hat. Die Pausen führten lediglich zu einer Verlängerung der Anwesenheitszeit, jedoch nicht zu einem Ausfall von Arbeitszeit.
Eine tarifvertragliche Regelung, die die gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause immer und unabhängig von der Arbeitszeitausfall zu vergüten hätte, existierte im GMTV nicht. Der Wortlaut war insoweit eindeutig: Eine Zahlungspflicht bestand nur dann, wenn die Pausen tatsächlich zur Minderung der zu leistenden Arbeitszeit führten.
2. Betriebsvereinbarung und die flexible Festlegung der Pausen
Der Betrieb des Arbeitgebers arbeitete auf Basis eines vollkontinuierlichen Fünfschichtsystems, das mit dem Betriebsrat vereinbart wurde. In diesem System arbeiteten die Beschäftigten je nach Schicht entweder 7 Stunden und 40 Minuten oder an Sonn- und Feiertagen 11 Stunden und 25 Minuten. Die Pausen wurden flexibel gehandhabt, und in der Betriebsvereinbarung hieß es: „Darüber hinaus werden jedem Mitarbeiter im 5-Schichtsystem pauschal 7,5 Einbringstunden pro Jahr für die Beibehaltung der flexiblen Pausengestaltung gutgeschrieben.“ Dies verdeutlicht, dass die flexible Handhabung der Pausen im Betrieb als zusätzlicher Vorteil für die Mitarbeiter verstanden wurde.
Das Gericht stellte klar, dass die flexible Gestaltung der Pausen durch betriebliche Anforderungen zwar zulässig sei, jedoch auch hier die Voraussetzung erfüllt sein müsse, dass der Arbeitnehmer zum Zweck der Erholung eine freie Nutzung der Pausenzeit sicherstellen könne.
3. Keine Vergütungspflicht nach Unionsrecht
Der Kläger argumentierte hilfsweise, dass die Ruhepausen nach europäischem Recht als vergütungspflichtige Arbeitszeiten anzusehen seien. Hierzu führte er an, dass die Anwesenheit in der Kantine, wo Störmeldungen der Maschinen angezeigt wurden, ihn in eine „Hab-Acht-Stellung“ versetzte, die eine tatsächliche Erholung unmöglich mache.
Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) schließen die Begriffe „Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ einander aus. Pausen, in denen ein Arbeitnehmer Einschränkungen unterliegt, die seine Möglichkeit, die Zeit frei zu gestalten und sich seinen eigenen Interessen zu widmen, erheblich beeinträchtigen, könnten unter Umständen als Arbeitszeit gewertet werden. Dies war im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben. Der Kläger war nicht verpflichtet, seine Pausen in der Kantine zu verbringen, und es gab keine Weisung des Arbeitgebers, bei Störungen sofort zu reagieren. Somit konnten die Pausen nicht als Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie angesehen werden.
Rechtliche Bewertung und Bedeutung für die Praxis
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zeigt einmal mehr die Bedeutung der klaren Abgrenzung zwischen Ruhezeiten und Arbeitszeiten im Sinne der gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen. Arbeitgeber sollten darauf achten, dass die Anforderungen an gesetzliche Pausen im Voraus feststehen und den Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, diese zur Erholung zu nutzen.
Betriebliche Erfordernisse, die eine flexible Handhabung der Pausen notwendig machen, sind möglich, dürfen jedoch nicht dazu führen, dass der Zweck der Erholung infrage gestellt wird. In diesem Fall wäre eine Vergütung der Pausen erforderlich.
Das Gericht betonte auch, dass der Schutz der Ruhepausen ein wichtiger Bestandteil des Arbeitnehmerschutzes ist. Arbeitnehmer, die Pausen im Rahmen ihrer Tätigkeit nehmen, müssen in der Lage sein, diese ungestört für die Erholung zu nutzen. Die reine Anwesenheitspflicht im Betrieb während der Pause reicht nicht aus, um die Pausen als vergütungspflichtige Arbeitszeit anzusehen, sofern keine wesentlichen Einschränkungen vorliegen.
Fazit
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts verdeutlicht, dass gesetzliche Ruhepausen, selbst im Dreischichtbetrieb, nur dann als vergütungspflichtige Arbeitszeit angesehen werden, wenn sie mit wesentlichen Einschränkungen einhergehen oder regelmäßig Arbeitszeit entfällt. Der Tarifvertrag, auf den sich der Kläger berief, sah eine solche Vergütung nur dann vor, wenn tatsächlich eine Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit vorliegt.
Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedeutet dies, dass die tarifvertraglichen und gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit und Pausengestaltung sorgfältig beachtet werden müssen, um Missverständnisse und mögliche Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Das Urteil zeigt die Bedeutung klarer Vereinbarungen und Regelungen zu Pausenzeiten auf und bietet eine wichtige Orientierungshilfe zur Frage der Vergütung von Ruhepausen.
Pausen sind zur Erholung da – und das sollte auch gewährleistet werden. Eine klare Trennung zwischen Arbeit und Pause hilft nicht nur den Arbeitnehmern, sondern schafft auch Klarheit und Rechtssicherheit für die Arbeitgeber.