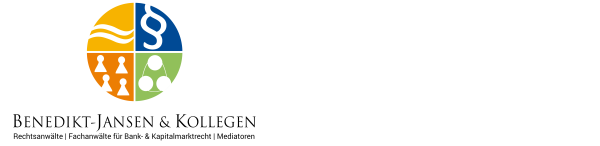Immer mehr Menschen entdecken Schwarmfinanzierung (Crowdfunding) als spannende Möglichkeit, ihr Geld anzulegen. Ob in innovative Start-ups, nachhaltige Projekte oder Immobilien – die Versprechen klingen oft verlockend. Doch was passiert, wenn das Investment schiefläuft? Welche Rechte haben Sie als Anleger, wenn die Versprechen nicht gehalten werden oder wichtige Informationen fehlten? Dieser Artikel beleuchtet die Rechtslage nach den deutschen Schwarmfinanzierungregelungen und gibt praktische Tipps.
1. Was ist Schwarmfinanzierung eigentlich?
Stellen Sie sich vor, viele Menschen legen kleine oder größere Beträge zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu finanzieren – sei es die Entwicklung eines neuen Produkts, der Bau einer Solaranlage oder die Expansion eines jungen Unternehmens. Genau das ist Schwarmfinanzierung. Meist geschieht dies über Online-Plattformen, die als Vermittler zwischen den Geldgebern (Anlegern) und den Geldnehmern (Projektträgern oder Unternehmen) auftreten.
Es gibt verschiedene Formen:
Crowdlending: Sie verleihen Geld und erhalten Zinsen (ähnlich einem Kredit).
Crowdinvesting: Sie beteiligen sich am Unternehmen oder Projekt und hoffen auf eine Rendite oder Gewinnbeteiligung.
Seit November 2021 gibt es mit der EU-Verordnung über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister (ECSP-VO) und dem deutschen Schwarmfinanzierung-Begleitgesetz einen neuen rechtlichen Rahmen, der europaweit für mehr Einheitlichkeit sorgen soll, zumindest für Projekte bis zu einem Volumen von 5 Millionen Euro.
2. Typische Risiken für Anleger bei Schwarmfinanzierungen
Trotz der Chancen birgt Schwarmfinanzierung auch erhebliche Risiken:
Totalverlust: Das Projekt kann scheitern, das Unternehmen insolvent werden. Im schlimmsten Fall ist Ihr eingesetztes Geld komplett weg.
Fehlende oder falsche Informationen: Die Projektbeschreibung oder die bereitgestellten Unterlagen können unvollständig, irreführend oder schlichtweg falsch sein.
Intransparenz: Manchmal ist schwer nachzuvollziehen, wie das Geld genau verwendet wird oder wie es um die wirtschaftliche Lage des Projekts steht.
Geringe Handelbarkeit: Anders als Aktien sind Crowdfunding-Anteile oft schwer oder gar nicht vorzeitig verkaufbar (Illiquidität).
Plattform-Risiko: Auch die vermittelnde Plattform selbst kann in Schwierigkeiten geraten oder ihre Pflichten verletzen.
3. Ihre Anspruchsgrundlagen, wenn was schief läuft
Wenn Sie als Anleger durch falsche, irreführende oder fehlende wichtige Informationen einen Schaden erleiden, stehen Sie nicht schutzlos da. Das Gesetz bietet verschiedene Ansatzpunkte, um Ersatz für Ihren Verlust zu fordern.
a) Haftung nach §§ 32c, 32d WpHG
Für Schwarmfinanzierungen, die unter die EU-Regeln fallen (bis 5 Mio. Euro), sind vor allem die §§ 32c und 32d des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) relevant.
Das zentrale Dokument: Das Anlagebasisinformationsblatt (ABIB) Jedes Projekt muss ein standardisiertes Informationsblatt bereitstellen, das sogenannte ABIB. Dieses soll Ihnen die wichtigsten Informationen über das Investment, die Chancen und vor allem die Risiken klar und verständlich darlegen und auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Wer haftet bei Fehlern im ABIB? Wenn das ABIB irreführende oder unrichtige Informationen enthält oder wichtige, für Ihre Anlageentscheidung erhebliche Informationen fehlen, können Sie Schadenersatz fordern. Verantwortlich und damit haftbar sind:
Der Projektträger: Also das Unternehmen oder die Person, die das Geld einsammelt (§ 32c WpHG).
Der Schwarmfinanzierungsdienstleister (die Plattform):
Verschulden:
Die Haftung ist allerdings auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Bei der Beweislast ist zu beachten: Sie als geschädigter Anleger müssen beweisen, dass die Informationen im ABIB falsch, irreführend oder unvollständig waren oder in sonstiger Weise den gesetzlichen Ansprüchen nicht entsprochen haben. Steht die Pflichtverletzung fest, muss der Verantwortliche beweisen, dass er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat.
b) Ältere Regeln: Das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)
Für Schwarmfinanzierungen, die nicht unter die neuen EU-Regeln fallen (z.B. weil das Volumen über 5 Mio. Euro liegt, aber keine Prospektpflicht nach dem strengeren Wertpapierprospektgesetz besteht, oder bei bestimmten Ausnahmen), kann das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) greifen.
Hier gibt es statt des ABIB oft ein Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB).
Die Haftung nach § 22 VermAnlG ist meist auf den Anbieter der Vermögensanlage beschränkt. Ob die Plattform darunterfällt, ist oft umstritten.
Wichtig: § 22 VermAnlG erfasst in der Regel nur unrichtige oder fehlende VIBs, nicht aber unvollständige.
Der Verschuldensmaßstab ist oft weniger streng (Haftung meist nur ab grober Fahrlässigkeit), dafür wird das Verschulden aber häufiger vermutet, was die Beweislage für Anleger verbessert.
c) Der allgemeine Rettungsschirm: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Unabhängig von diesen Spezialgesetzen können sich Ansprüche auch aus dem allgemeinen Zivilrecht ergeben, insbesondere verletzte Aufklärungspflichten im Vorfeld eines Vertragsabschlusses (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB).
4. Konkrete Handlungsoptionen im Schadensfall: Was tun, wenn's brennt?
Wenn Sie glauben, durch fehlerhafte Informationen geschädigt worden zu sein, sollten Sie strukturiert vorgehen:
Sachverhalt klären: Stellen Sie alle Unterlagen zusammen. Was genau war falsch oder fehlte? Welcher Schaden ist Ihnen entstanden?
Kontakt aufnehmen: Schreiben Sie den Projektträger und/oder die Plattform an. Schildern Sie den Sachverhalt und bitten Sie um Stellungnahme oder eine Lösung. Setzen Sie eine Frist.
Rechtsrat einholen: Spätestens wenn keine zufriedenstellende Antwort kommt, können Sie sich an uns wenden. Wir sind eine Kanzlei mit erfahrenen Rechtsanwälten im Bank-und Kapitalmarktrecht. Wir prüfen die Erfolgsaussichten, klären die Haftungsfrage und empfehlen Ihnen die nächsten Schritte.
WICHTIG: Fristen beachten (Verjährung)! Ihre Ansprüche verjähren!
5. Präventive Schutzmaßnahmen: Vorsicht ist besser als Nachsicht
Am besten ist es natürlich, wenn es gar nicht erst zum Schadensfall kommt. Mit diesen Tipps minimieren Sie Ihr Risiko:
Checkliste für Anleger:
Geschäftsmodell verstehen: Ist die Idee plausibel? Wie soll Geld verdient werden?
ABIB/VIB kritisch lesen: Sind alle Risiken klar benannt? Fehlen wichtige Infos (z.B. zur Konkurrenz, zu den Kosten)?
Recherche: Wer steckt hinter dem Projekt? Welche Erfahrung hat das Management? Was sagt die Online-Suche über Projekt und Plattform?
Plattform-Check: Ist der Schwarmfinanzierungsdienstleister bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) registriert und zugelassen?
Risiko-Abgleich: Passen die genannten Risiken zu meiner eigenen Risikobereitschaft?
Verlust-Toleranz: Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie im Zweifel verkraften können!
Rendite-Versprechen: Seien Sie skeptisch bei unrealistisch hohen Renditeversprechen! Hohe Rendite bedeutet meist hohes Risiko.
Streuung: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte. Verteilen Sie Ihr Geld auf verschiedene Anlagen (Diversifikation).
Zweite Meinung: Holen Sie bei Unsicherheiten unabhängigen Rat ein (z.B. von Verbraucherzentralen oder einem Honorarberater).
6. Fazit: Informiert investieren, Rechte kennen
Schwarmfinanzierung ist ein dynamischer Markt mit Chancen, aber eben auch signifikanten Risiken. Die §§ 32c, 32d WpHG enthalten neue, spezielle Haftungsregeln, die Anlegern bei fehlerhaften oder unvollständigen Anlagebasisinformationsblättern (ABIB) grundsätzlich Rechte auf Schadenersatz geben.
Seien Sie kritisch, informieren Sie sich umfassend bevor Sie investieren (Due Diligence!), und scheuen Sie sich nicht, bei Problemen Ihre Rechte geltend zu machen – am besten mit professioneller Unterstützung und unter Beachtung der Verjährungsfristen.