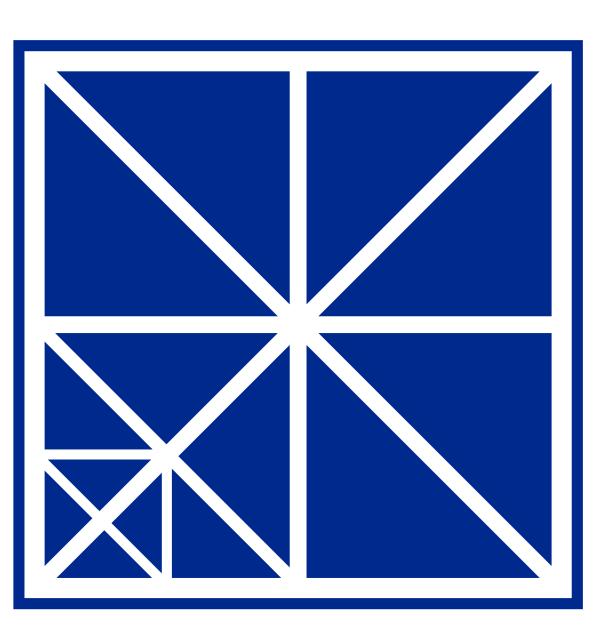I. Problemstellung
Bei der Vergütung von angestellten Zahnärzten, Tierärzten, Rechtsanwälten oder anderen Freiberuflern ist es üblich, dass diese einen variablen Bestandteil – oftmals in Form einer Umsatzbeteiligung – aufweist. Ein oft verwendetes, dynamisches Umsatzbeteiligungsmodell kann sich beispielsweise derart gestalten, dass neben der Grundvergütung ab einem gewissen Sockelbetrag eine Umsatzbeteiligung gezahlt wird. In derartigen Vergütungsmodellen stellt sich die Frage, ob die Zahlung dieser Umsatzbeteiligung auch im Krankheits- oder Urlaubsfall zu leisten ist.
Maßgeblich für die Beantwortung dieser Frage ist primär die vertragliche Regelung, da die Anspruchsgrundlage für die Umsatzbeteiligung die vertragliche Abrede ist. Daher ist die Wirksamkeit und die Auslegung der arbeitsvertraglichen Klauseln entscheidend. Hierbei kommt es auf viele arbeitsvertragliche Faktoren an. Jedenfalls bei einer monatlichen Vereinbarung – Ausnahmen möglich – gelten die folgenden Grundsätze:
II. Grundsätze
Bei monatlichen Umsatzbeteiligungsmodellen handelt es sich laut der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht um Sonderzahlungen, sondern um regelmäßiges Entgelt aus dem Arbeitsvertrag und folglich um Entgelt, welches auch während der Krankheit und während der Zeiten des Erholungsurlaubs weiterzuzahlen ist (BAG, Urteil vom 08.09.1998 – 9 AZR 223/97).
Im Krankheitsfall wird entsprechend § 4 Entgeltfortzahlungsgesetz das durchschnittliche Gehalt für den Krankheitszeitraum zugrunde gelegt. Ausgangspunkt hierfür muss auch für Fälle einer variablen Vergütung in Gestalt einer Umsatzbeteiligung der Verdienst der Vergangenheit sein. Der heranzuziehende Referenzzeitraum unterliegt dem Ermessen des Gerichts nach § 287 ZPO. Laut dem LAG Mainz (LAG Rheinland-Pfalz, 05.09.2007 – 8 Sa 165/07) – und insoweit schließen sich die meisten Landesarbeitsgerichte dieser Rechtsprechung an – sind dies die letzten 12 Wochen vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit. Demzufolge ist das durchschnittliche Entgelt einschließlich der zu zahlenden Umsatzbeteiligung für diesen Zeitraum zugrunde zu legen.
Gleiches gilt auch für die Zeiten von Urlaub nach § 11 Abs. 1 S. 1 Bundesurlaubsgesetz. Hierbei ist ausweislich des eindeutigen Gesetzeswortlauts zur Berechnung des Urlaubsentgelts der durchschnittliche Verdienst der letzten dreizehn Wochen vor Beginn des Urlaubs zugrunde zu legen. Außer Betracht bleiben bei dieser Berechnungsmethode nach § 11 Abs. 1 S. 3 BUrlG diejenigen Verdienstkürzungen in Form von unverschuldeter Arbeitsversäumnis, worunter auch unter anderem die Krankheit fällt. Der Gesetzgeber stellt dadurch klar, dass zufällige Ereignisse außerhalb der Sphäre von der Möglichkeit der Einflussnahme des Arbeitnehmers unberücksichtigt bleiben sollen und damit auch beispielsweise ein Mindestumsatz, welcher hypothetisch generiert worden wäre.
Eine monatliche zu zahlende Umsatzbeteiligung fällt damit in das Bruttomonatsentgelt, welches in den Bemessungszeiträumen für Zeiten des Erholungsurlaubs und Krankheit Berücksichtigung zu finden hat. Hinsichtlich anders lautender Abreden ist eine individuelle Prüfung erforderlich, ob und inwieweit diese unter die vorgenannten Grundsätze der Rechtsprechung fallen oder eine anderweitige, wirksame Vereinbarung getroffen wurde.
III. Ausschlusstatbestand wegen Verfristung
Der Anspruch auf die rückwirkende Zahlung der Umsatzbeteiligung kann jedoch aufgrund einer arbeitsvertraglichen Ausschlussklausel ausgeschlossen sein. Solche Klauseln beziehen sich in der Regel auf Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, die innerhalb von (regelmäßig) drei Monaten nach Fälligkeit geltend gemacht werden müssen. Die Fälligkeit der Zahlung der Umsatzbeteiligung ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag. Regelmäßig tritt die Fälligkeit mit Ablauf des Abrechnungsmonats oder dem darauffolgenden ein. Dies dürfte aber je nach dem variieren, welche Art Umsatzbeteiligung gezahlt wird, d.h. ob diese monatliche, quartalsweise oder mit einer anderen Bestimmung gezahlt wird.
Derartige Klauseln sind sehr oft rechtsunwirksam. Das Ergebnis kann im Einzelfall variieren, sodass eine konkrete rechtliche Überprüfung, insbesondere anhand des Transparenzgebots des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB und der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 2 BGB, zur Beurteilung erforderlich ist.
Unter anderem kann sich eine Unwirksamkeit einer Ausschlussklausel daraus ergeben, wenn eine Verfallfrist nicht auf die Fälligkeit eines Anspruchs abstellt, sondern auf einen feststehenden Zeitpunkt – wie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Darüber hinaus müssen nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts die Ausschlussfristen für beide Parteien gleichermaßen gelten und eine Mindestfrist von drei Monaten vorsehen. Zudem ist der Ausschluss sämtlicher Ansprüche, die im Ergebnis dazu führen, dass der Mindestlohn unter anderem nach dem MiLoG unterlaufen wird, ausgeschlossen (BAG, Urteil vom 24.08.2016 – 5 AZR 703/15).
Ist die Ausschlussklausel unwirksam, greifen die allgemeinen Regelungen der Verjährung nach §§ 195, 199 Abs. 1 BGB, sodass Beträge rückwirkend für drei Jahre geltend gemacht werden können. Bei einer Geltendmachung im Jahr 2024 bezieht sich dies demnach auf Beträge von nicht gezahlter Umsatzbeteiligung im Krankheitsfall und Zeiten von Erholungsurlaub für 2023, 2022 und 2021.
Für den Fall, dass sich die Ausschlussfrist als wirksam erweist, ist Eile bei der Geltendmachung geboten! Wird der Zahlungsanspruch nicht innerhalb der vereinbarten Frist gegenüber dem Arbeitgeber geltend gemacht, ist dieser nicht mehr durchsetzbar, wenngleich gilt, dass die Ausschlussfrist vom Arbeitgeber einzuwenden ist.
IV. Gestaltung von Klauseln
Grundsätzlich gelten die vorstehenden Erwägungen auch für andere vereinbarte Modalitäten als die monatliche zu zahlende Umsatzbeteiligung. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob mit einer Zahlung eine auf einen bestimmten Zeitabschnitt entfallende Arbeitsleistung vergütet wird. Welcher Zeitabschnitt diesbezüglich konkret vereinbart ist, ist dabei unerheblich. So kann beispielsweise eine jährliche Abrechnung oder ein sonstiger Abrechnungsrhythmus vereinbart werden, wenn sich dies aus Praktikabilitätsgründen anbietet zum Beispiel wegen Schwankungen von Zahlungseingängen.
Hierbei gilt es jedoch eine wirksame Klausel zu gestalten, welche den Interessen der Vertragsparteien gerecht wird. Aufgrund der Rechtsprechung zu dieser höchst komplexen Materie ist hierbei die Beratung durch eine Fachanwaltskanzlei unvermeidbar.
V. Fazit und Handlungsempfehlung
Nach alledem ist zu statuieren, dass grundsätzlich ein Anspruch auf die Zahlung der Umsatzbeteiligung auch während Zeiten von Krankheit und Erholungsurlaub besteht. Im Einzelfall kann dieser Anspruch jedoch aufgrund diverser Gründe ausgeschlossen sein oder durch wirksame arbeitsvertragliche Grundlagen eine andere Vereinbarung gestaltet werden.
Dr. Michael Heintz
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht