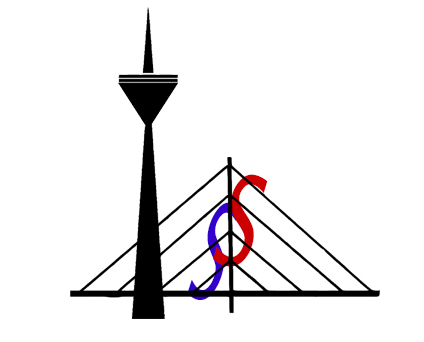Ein Rennen mit Folgen
Seit einigen Jahren wird gegen sogenannte „Raser“ härter vorgegangen – insbesondere seit mehrere spektakuläre Rennen mit tödlichem Ausgang bundesweit Schlagzeilen machten. § 315d StGB („Verbotene Kraftfahrzeugrennen“) ist seit 2017 in Kraft und hat sich seither zu einem praxisrelevanten Straftatbestand im Verkehrsstrafrecht entwickelt.
In diesem Rechtstipp erfahren Sie, wann eine Fahrt als verbotenes Rennen gilt, wann strafrechtliche Verantwortung droht, welche zusätzlichen Risiken bestehen – und wie Sie sich im Ermittlungsverfahren gegenüber der Polizei verhalten sollten.
1. Wann liegt ein verbotenes Rennen im Sinne von § 315d StGB vor?
Der Begriff „Rennen“ wird in der Alltagssprache meist mit einem klassischen Wettbewerb zwischen zwei oder mehr Fahrzeugen verbunden. Der Gesetzgeber verfolgt jedoch einen deutlich weiteren Ansatz: Auch Alleinfahrten – also Fahrten ohne Gegenspieler – können strafbar sein.
§ 315d StGB unterscheidet drei Hauptvarianten:
a) Teilnahme an einem nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennen (§ 315d Abs. 1 Nr. 1)
Dies ist die bekannteste Konstellation: Zwei oder mehr Fahrer verabreden sich, um sich im öffentlichen Straßenverkehr ein Rennen zu liefern. Die bloße Teilnahme reicht aus – selbst wenn keine konkreten Verkehrsverstöße oder Gefährdungen hinzukommen.
Beispiele:
- Ein Ampelduell zwischen zwei Fahrzeugen mit Vollgasstart
- Verabredete Nachtfahrten auf der Stadtautobahn mit Höchstgeschwindigkeit
- Rennen auf Landstraßen zwischen Motorrädern
b) Durchführung oder Veranstaltung eines Rennens (§ 315d Abs. 1 Nr. 2)
Wer ein solches Rennen organisiert, es durchführt oder als Mittäter ermöglicht, kann ebenso bestraft werden wie die Teilnehmer. Auch Beifahrer, die zu einem Rennen anstacheln oder es filmen, können in besonderen Fällen belangt werden.
c) Rennähnliche Alleinfahrt (§ 315d Abs. 1 Nr. 3)
Diese Vorschrift betrifft Fälle, in denen ein Fahrer ohne Gegenspieler unterwegs ist, aber mit der Absicht fährt, „die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“. Eine konkrete Absprache mit anderen ist nicht erforderlich.
Beispielhafte Konstellationen:
- Stark beschleunigtes Fahren auf einer innerstädtischen Straße bei Nacht
- Fahren mit stark überhöhter Geschwindigkeit bei dichtem Verkehr
- „Ausfahren“ eines getunten Wagens auf öffentlichen Straßen
Ob ein solcher „Renntatbestand“ vorliegt, hängt von den Gesamtumständen ab – insbesondere von der subjektiven Absicht des Fahrers und dem objektiven Fahrverhalten.
2. Wann wird die Tat besonders schwerwiegend?
Eine Strafschärfung tritt ein, wenn es durch das Rennen oder das Fahrverhalten zu einer konkreten Gefährdung kommt, etwa:
- Beinahe-Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern
- gefährliche Fahrmanöver im dichten Stadtverkehr
- Missachtung von roten Ampeln oder Fußgängerüberwegen
Kommt es durch das Rennen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten oder Toten, liegt regelmäßig eine besonders schwere Tatvariante nach § 315d Abs. 5 StGB vor. In besonders tragischen Fällen wird auch der Straftatbestand des Mordes (§ 211 StGB) geprüft – insbesondere, wenn dem Fahrer ein sogenannter bedingter Tötungsvorsatz nachgewiesen werden kann.
3. Der Berliner Ku’damm-Fall und das BGH-Urteil
Ein wegweisender Fall in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Berliner Ku’damm-Fall:
Im Jahr 2016 lieferten sich zwei junge Männer in Berlin ein nächtliches Rennen auf dem Kurfürstendamm. Sie fuhren mit über 160 km/h durch die Innenstadt und missachteten dabei mehrere rote Ampeln. Bei einer Kreuzung kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines unbeteiligten Mannes, der noch am Unfallort verstarb.
Das Landgericht Berlin verurteilte die beiden Täter wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Das Gericht sah in ihrem Verhalten einen bedingten Tötungsvorsatz: Ihnen sei bewusst gewesen, dass sie durch ihr Fahrverhalten den Tod eines anderen billigend in Kauf genommen hätten.
Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte in seinem Urteil vom 1. März 2018 (Az. 4 StR 399/17) grundsätzlich die Möglichkeit einer Verurteilung wegen Mordes, wenn das Fahrverhalten derart riskant ist, dass eine tödliche Kollision vorhersehbar und vom Fahrer hingenommen wurde.
Dieses Urteil hat die strafrechtliche Einordnung von Rennfahrten mit tödlichem Ausgang maßgeblich geprägt.
4. Strafrechtliche Konsequenzen im Überblick
Je nach Einzelfall sieht § 315d StGB folgende Sanktionen vor:
- Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bei bloßer Teilnahme ohne Gefährdung
- Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bei konkreter Gefährdung anderer oder von Sachwerten (z. B. Fahrzeuge)
- Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bei besonders schweren Folgen (z. B. Körperverletzung oder Tod)
- Lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes (§ 211 StGB), wenn ein Tötungsvorsatz nachgewiesen wird
In allen Fällen drohen zusätzlich:
- Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB)
- Sperrfrist für die Wiedererteilung
- Anordnung einer MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung)
- Eintrag im Führungszeugnis
- 3 Punkte im Fahreignungsregister (Flensburg)
Die strafrechtlichen Konsequenzen sind somit massiv – selbst bei Ersttätern.
5. Versicherungsrechtliche und wirtschaftliche Folgen
Viele Betroffene unterschätzen die finanziellen Auswirkungen eines Rennverfahrens:
- Die Kfz-Haftpflichtversicherung kann bei Vorsatz bis zu 5.000 Euro Regress fordern – z. B. bei Schäden an Dritten.
- Die Kaskoversicherung (Voll- oder Teilkasko) verweigert in der Regel jede Zahlung, wenn das Verhalten vorsätzlich oder grob fahrlässig war.
- Bei Personenschäden sind zivilrechtliche Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen im sechsstelligen Bereich nicht ungewöhnlich.
- Hinzu kommen Kosten für das Strafverfahren, etwa für Verteidigung, Sachverständige, Gutachten, MPU und gerichtliche Gebühren.
In der Praxis geraten Betroffene durch diese Kosten schnell an ihre wirtschaftliche Belastungsgrenze.
6. Berufliche und persönliche Konsequenzen
Ein Verfahren oder eine Verurteilung nach § 315d StGB kann sich negativ auf das Berufsleben auswirken, insbesondere:
- Verlust des Arbeitsplatzes bei beruflicher Fahrpflicht (z. B. Außendienst, Kurierdienste, Handwerk)
- Ausschluss aus bestimmten Tätigkeiten (z. B. Taxi-, Bus- oder Transportgewerbe)
- Schwierigkeiten bei der Aufnahme in sicherheitsrelevante Berufe (z. B. Polizei, Justiz, Luftfahrt)
- Eintrag im Führungszeugnis – mit möglichen Auswirkungen auf Bewerbungen oder bestehende Verträge
Je nach beruflichem Umfeld kann bereits die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen.
7. Wie sollte man sich bei polizeilichen Maßnahmen und Vernehmungen verhalten?
Wer als Beschuldigter in einem Verfahren wegen § 315d StGB geführt wird – etwa durch eine Vorladung, ein Anhörungsschreiben oder nach einer Kontrolle –, sollte sich unbedingt über seine Rechte im Klaren sein.
Grundsatz: Schweigen ist kein Schuldeingeständnis – sondern ein Recht
- Sie sind nicht verpflichtet, zur Sache auszusagen – weder gegenüber der Polizei noch der Staatsanwaltschaft.
- Auch scheinbar entlastende Aussagen („Ich habe das nicht ernst gemeint“, „Es war nur ein kurzer Sprint“) können belastend interpretiert werden.
- Aussagen in der frühen Phase des Verfahrens – insbesondere zur Motivation oder Fahrweise – prägen die juristische Bewertung entscheidend.
- Wer voreilig über seine Absichten spricht, erleichtert es der Staatsanwaltschaft, den erforderlichen Vorsatz zu konstruieren.
Daher gilt: Keine Aussagen gegenüber Polizei oder Zeugen – stattdessen anwaltliche Beratung einholen und zunächst nur die Formalien zur Person bestätigen.
Ein erfahrener Verteidiger kann die Ermittlungsakte einsehen, die Beweislage einschätzen und anschließend gemeinsam mit Ihnen eine geeignete Verteidigungsstrategie entwickeln – sei es zur Einstellung des Verfahrens, zur Strafmilderung oder zum Nachweis der Unschuld.
Fazit
Der Straftatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach § 315d StGB ist weit gefasst und wird in der Praxis streng verfolgt. Schon riskante Einzelaktionen oder spontane Beschleunigungen im Stadtverkehr können als strafbares Rennen gewertet werden. Kommt es zu einer konkreten Gefährdung oder gar einem Unfall mit Todesfolge, drohen gravierende rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen – bis hin zur Verurteilung wegen Mordes.
Umso wichtiger ist es, frühzeitig Verteidigungsmöglichkeiten zu erkennen und Fehler – insbesondere in der Kommunikation mit Polizei und Ermittlungsbehörden – zu vermeiden. Ein ruhiges, besonnenes Vorgehen und professionelle juristische Unterstützung können in solchen Verfahren entscheidend sein.
Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Wenn Sie selbst betroffen sind, sollten Sie sich frühzeitig anwaltlich beraten lassen.
Rechtsanwalt Giesen ist seit 20 Jahren im Verkehrsrecht und im Strafrecht tätig. Er hat in vielen 100 Fällen erfolgreich verteidigt und schlimme Folgen verhindern können.
In dringenden Fällen steht er Ihnen auch kurzfristig telefonisch für eine erste kostenlose Einschätzung zur Verfügung. In jedem Fall ist eine anwaltliche Beratung günstiger als die Folgen einer verunglückten Verteidigung.
Sprechen Sie mit uns, bevor sie mit Personen sprechen, die gegen sie ermitteln!