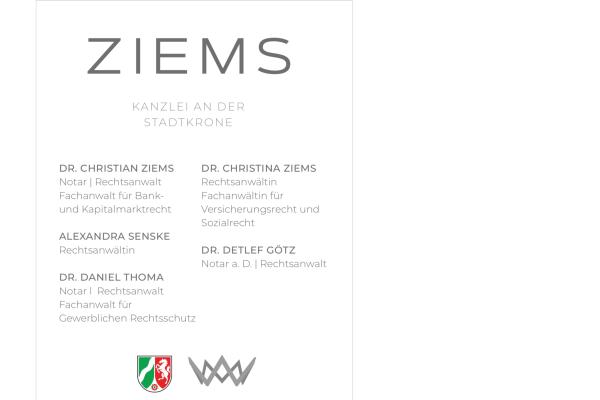Rechtstipp für Betroffene von sexualisierter Gewalt im kirchlichen Kontext
Verjährung, außergerichtliche Anerkennungsleistungen und aktuelle Entwicklungen
Immer mehr Betroffene sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche suchen rechtlichen Beistand. Im Mittelpunkt steht häufig die Frage: Können meine Ansprüche noch geltend gemacht werden – oder sind sie verjährt? Dieser Beitrag gibt einen strukturierten Überblick über die rechtliche Lage zur Verjährung, die Möglichkeiten außergerichtlicher Anerkennungsleistungen sowie aktuelle gerichtliche Entwicklungen, insbesondere die bevorstehende Entscheidung des OLG Koblenz.
1. Verjährung zivilrechtlicher Ansprüche – was gilt für Missbrauchsfälle?
Zivilrechtliche Ansprüche auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz unterliegen grundsätzlich bestimmten Verjährungsfristen. Für Betroffene sexualisierter Gewalt – insbesondere in Kindheit oder Jugend – gelten folgende Regelungen:
a) Beginn der Verjährung erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres
Bei Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern oder Jugendlichen beginnt die Verjährungsfrist nicht vor dem 18. Lebensjahr des Betroffenen zu laufen. (§ 208 BGB)
Beispiel: Ein Betroffener, der als 12-Jähriger missbraucht wurde, hat ab dem 18. Geburtstag – nicht früher – die Möglichkeit, die Frist zu starten.
b) Drei Jahre ab Kenntnis – relative Verjährung
Nach § 199 Abs. 1 BGB verjähren Ansprüche drei Jahre nach dem Ende des Jahres, in dem der oder die Betroffene Kenntnis von der Tat und dem Täter erlangt hat. Diese Frist ist kenntnisabhängig und kann sich dadurch weit ins Erwachsenenalter verschieben.
c) Absolute Verjährung nach 30 Jahren
Unabhängig von der Kenntnis gilt eine absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren ab der Tatbegehung (§ 199 Abs. 3a BGB). Danach ist eine zivilrechtliche Klage regelmäßig ausgeschlossen.
Diese 30-Jahres-Frist steht zunehmend in der Kritik, weil sie der späten Aufarbeitung vieler Betroffener nicht gerecht wird. Juristisch ist derzeit unklar, ob diese Frist in Fällen systematischer Vertuschung oder institutionellen Fehlverhaltens ausnahmsweise durchbrochen werden kann.
2. Unterschiedliches Verhalten der Bistümer
In der Praxis zeigt sich: Nicht alle Bistümer handeln einheitlich.
Einige Bistümer verzichten bewusst auf die Einrede der Verjährung, insbesondere um das Anerkenntnis der institutionellen Verantwortung zu unterstreichen ( bisher zum Beispiel das Bistum Essen).
Andere berufen sich ausdrücklich auf die Verjährung (Beispiel Bistum Aachen), selbst in Fällen, in denen das Leid unstreitig ist. Das führt zu einer teils massiven Belastung der Betroffenen, insbesondere wenn sie vor Gericht abgewiesen werden.
3. Aktuelle Rechtsprechung – Bedeutung der Entscheidung des OLG Koblenz
- Die Rechtsprechung ist bislang nicht auf Seiten der Missbrauchsopfer:
Zuletzt wies das Landgericht Trier mehrere Klagen von Betroffenen wegen sexuellen Missbrauchs aus den 1970er-Jahren mit Hinweis auf die Verjährung ab.
In einem dieser Fälle wurde Berufung beim Oberlandesgericht Koblenz eingelegt. Die Entscheidung wird für das Jahr 2025 erwartet.
- Diese bevorstehende Entscheidung des OLG Koblenz ist von besonderer Bedeutung:
Es handelt sich um eine der ersten obergerichtlichen Bewertungen zur Verjährungsproblematik bei kirchlichem Missbrauch. Die Entscheidung könnte Maßstäbe setzen – etwa zur Frage, ob und wann die absolute Verjährung durch neue rechtliche Wertungen oder Grundsätze der Billigkeit durchbrochen werden kann. 4. Alternative: Außergerichtliche Anerkennungsleistungen über die UKA
- Unabhängig von gerichtlichen Verfahren besteht die Möglichkeit, außergerichtliche Anerkennungsleistungen bei der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) zu beantragen. Dieses Verfahren wurde von der Deutschen Bischofskonferenz eingerichtet.
Vorteile:
Keine gerichtliche Beweisführung notwendig – eine plausible Schilderung genügt.
Auch verjährte Fälle werden berücksichtigt.
Die Höhe orientiert sich an der Schmerzensgeldpraxis deutscher Gerichte:
In vielen Fällen: vier- bis fünfstellige Beträge
In besonders schweren Fällen: über 100.000 Euro
Seit März 2023:
Widerspruchsrecht bei Unzufriedenheit mit der Entscheidung
Akteneinsicht für Betroffene
- Die UKA kann damit eine wichtige Option sein – insbesondere dann, wenn eine gerichtliche Geltendmachung aussichtslos erscheint oder zu belastend wäre.
- Nachteile: Extrem lange Bearbeitungsdauer, Entscheidungen sind nicht nachvollziehbar.
Ihre
Dr. Christina Ziems
Rechtsanwältin
____________________________________________
ZIEMS
Kanzlei an der Stadtkrone
Pariser Bogen 7
44269 Dortmund
Tel. 0231/700 125 00
Fax. 0231/700 125 55
Email: christina.ziems@kanzlei-an-der-stadtkrone.dewww.kanzlei-an-der-stadtkrone.dehre
Dr. Christina Ziems
Rechtsanwältin
____________________________________________
ZIEMS
Kanzlei an der Stadtkrone
Pariser Bogen 7
44269 Dortmund
Tel. 0231/700 125 00
Fax. 0231/700 125 55
Email: christina.ziems@kanzlei-an-der-stadtkrone.dewww.kanzlei-an-der-stadtkrone.de
- Dr. Christina Ziems
Rechtsanwältin
____________________________________________
ZIEMS
Kanzlei an der Stadtkrone
Pariser Bogen 7
44269 Dortmund
Tel. 0231/700 125 00
Fax. 0231/700 125 55
Email: [email protected]www.kanzlei-an-der-stadtkrone.de