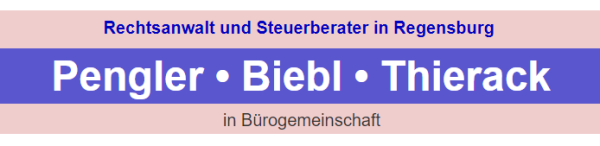„Viele Kinder streiten um das Erbe ihrer Eltern, aber niemand streitet sich darum sie zu pflegen.“
Ein Satz der mehr Wahrheit nicht enthalten könnte.
Immer wieder kommt es im Rahmen erbrechtlicher Auseinandersetzungen unter Geschwistern zu Streitigkeiten darüber, ob und in welchem Umfang Leistungen zugunsten des Verstorbenen erbracht wurden und wie diese bei der Erbauseinandersetzung zu berücksichtigen sind. Hauptanwendungsfall sind dabei erbrachte Pflegeleistungen. Denn meist hat eines von mehreren Kindern die Pflege der Eltern übernommen, dafür möglicherweise auch Einschränkungen hingenommen. Würden alle das gleich große Stück Kuchen aus dem Nachlass der Eltern erhalten, wäre das nicht ungerecht?
Die Thematik hat in den vergangenen Jahren erhebliche soziale und gesellschaftspolitische Bedeutung erlangt. Während früher die Pflegeleistungen besonders in Großfamilien, selbstverständlich war, ist dies heute nur noch eingeschränkt der Fall. In der Regel sind die Kinder der Pflegebedürftigen, sowie deren Ehegatten voll berufstätig, die Lebenserwartung der Eltern steigt, damit aber auch gleichzeitig der Bedarf an Pflegeleistungen. Dies kann durch das Gesundheitssystem oft nicht mehr oder nur unter hohem Vermögenseinsatz geleistet werden.
Daher sollen Pflegeleistungen von Abkömmlingen, nach dem Tod des gepflegten Elternteils, honoriert werden, sofern dies zu einer Vermögensschonung des Erblassers führte. Hierzu bildet § 2057a BGB die Anspruchsgrundlage.
"Wer durch Mitarbeit im Haushalt, Beruf oder Geschäft des Erblassers während längerer Zeit, durch erhebliche Geldleistungen oder in anderer Weise in besonderem Maße dazu beigetragen hat, dass das Vermögen des Erblassers erhalten oder vermehrt wurde, kann bei der Auseinandersetzung eine Ausgleichung unter den Abkömmlingen verlangen, die mit ihm als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen;"
Anders als in der Vorgängerregelung ist in der aktuellen Fassung der Norm nicht mehr erforderlich, dass der Pflegende auf eigenes Einkommen verzichtet, wodurch die Praxisrelevanz um ein Vielfaches erhöht wurde. Wichtig ist vielmehr, dass durch die Pflegeleistungen des Abkömmlings, über einen längeren Zeitraum hinweg, Fremdpflegeleistungen entbehrlich bleiben und das Vermögen, das für Fremdpflegeleistungen aufgewendet hätte werden müssen im Vermögen des Elternteils verbleibt.
Leider hat der Gesetzgeber keine klare Vorgabe dahingehend gegeben, welche Leistungen tatsächlich honorierungsfähig sind und wie der Wert der Pflegeleistungen zu bemessen ist. Die Höhe ist nach Billigkeit und bemessen. Dies ist Aufgabe der Rechtsprechung, aus der sich zwischenzeitlich Anhaltspunkte dafür ableiten lassen, wann Pflegeleistungen Ausgleichung fähig sind, welche Anforderungen an die Nachweise gestellt werden und in welcher Höhe die Ausgleichung durchzuführen. So hat das OLG Schleswig in seinem Urteil vom 22.11.2016 die einzelnen Prüfungsschritte sehr ausführlich dargestellt und sich auch intensiv mit der Bemessung der Höhe der Ausgleichsansprüche auseinandergesetzt. Ebenso das OLG Frankfurt am Main in seiner Entscheidung vom 07.02.2020.
Zur Definition der Pflegeleistungen wird in der Regel auf § 14 SGB XI zurückgegriffen. Die Höhe des ausgleichungsfähigen Betrages bemisst sich nach Billigkeit. Hier wird in der Regel auf ersparte Kosten für Fremdpflege zurückgegriffen. Zudem wird der ideelle Wert und damit die besondere Bedeutung der Pflegeleistung für den Erblasser bei der Bemessung des Wertes der erbrachten Leistungen berücksichtigt.
Beweispflichtig für die Art, Umfang und die Dauer der Pflegeleistungen ist derjenige, der die Pflegeleistungen auch tatsächlich erbracht hat und sich auf den Anspruch beruft. Dabei sind aber die Anforderungen nicht zu überziehen. Die bereits erwähnte Entscheidung des OLG Frankfurt setzt sich hier mit der Beweisführung anschaulich auseinander.
Dass in dieser offenen gesetzlichen Regelung, mit entsprechender Nachweispflicht des pflegenden Abkömmlings, die oft nicht oder nur schwerlich erfüllt werden kann, ein massives Konfliktpotenzial zwischen Kindern, die die Eltern gepflegt haben und Kindern die sich nicht um die Eltern gekümmert haben liegt, muss sicherlich nicht näher beschrieben werden. Letztlich hat jeder die Befürchtung zu wenig aus dem hinterlassenen Topf zu bekommen.
Der Ausgleich, den § 2057a BGB gewährt, ist kein Geldanspruch gegen den Nachlass und damit keine Nachlassverbindlichkeit. Vielmehr verschieben sich lediglich die rechnerischen Teilungsquoten und damit die Erbquoten.
Nicht übersehen werden darf aber zudem, dass der Erblasser die Möglichkeit hat, im Rahmen der testamentarischen Verfügung diese Ausgleichung auszuschließen.
Es gibt andere Wege, die Honorierung von Pflegeleistungen sicherzustellen, und zwar zu Lebzeiten des gepflegten Elternteils in einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Elternteil, in Form eines so genannten Pflegevertrages.
Wer keinen Pflegevertrag hat, dennoch Pflegeleistungen erbringt, sollte an eine Dokumentation seiner Leistungen denken.
Sollten Sie Fragen zu diesem Thema oder anderen Bereichen des Erbrechts haben, kontaktieren Sie mich gerne.