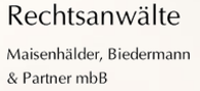Whistleblowing kann tatsächlich Stress am Arbeitsplatz erzeugen. Dann nämlich, wenn der Hinweisgeber eine Falschmeldung macht. Und er den dadurch entstandenen Schaden übernehmen muss.
Nach zähem Ringen hat auch der deutsche Gesetzgeber die die RL 2019/1937 „zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“ in Form des Hinweisgeberschutzgesetzes in deutsches Recht umgesetzt. Wir stellen in Kürze das Wichtigste dar:
Zunächst gilt zu beachten, dass nach § 1 HinSchG nur Personen geschützt sind, die Informationen im Zusammenhang mit oder im Vorfeld von ihrer beruflichen Tätigkeit erhalten haben – die Offenlegung privaten Wissens ist damit nicht geschützt. Inhaltlich umfasst der Schutz nach § 2 HinSchG im Wesentlichen bußgeld- und strafbewehrte Verstöße sowie Verstöße gegen Unionsrecht oder mit diesem korrespondierenden nationalen Regelungen.
Der Hinweisgebende „soll“ nach § 7 HinSchG eine interne Meldestelle bevorzugen – ver-pflichtend ist dies jedoch nicht. Jedenfalls kann sich der Hinweisgeber aber auch nach einem internen Hinweis auch weiterhin an externe Meldestellen wenden. Das entscheidende Wort hierbei ist „Meldestelle“. Der Hinweisgeber kann sich nämlich nicht an jeden wenden, sondern nur an die internen Meldestellen (§ 12 HinSchG) und die externen Meldestellen (§§ 19 – 23 HinSchG). Erst danach kann ggf. nach § 32 HinSchG eine Weitergabe von Informationen an externe Stellen zulässig sein.
Hat der „Whistleblower“ ordnungsgemäß Meldung gemacht, ist er nach § 36 HinSchG von Repressalien geschützt. Nach § 38 HinSchG kann jedoch auch der Hinweisgeber nach einer Falschmeldung zu Schadenersatz verpflichtet sein. Es ist also sinnvoll, sich vor einer Hinweismeldung erstmal anwaltlichen Rat zu holen.
Gerne helfe ich Ihnen! Rufen Sie mich an! Meine Tel. Nr. 08331/95210. Ich berate und vertreten Sie außergerichtlich und vor Gericht!