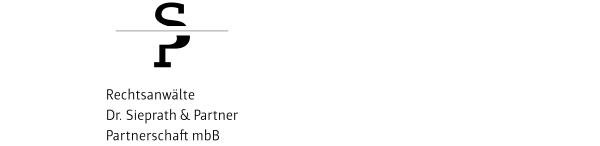Ein Insolvenzantrag durch eine Krankenkasse oder das Finanzamt kann für Unternehmen existenzbedrohend sein. Insbesondere offene Sozialversicherungsbeiträge oder Steuerschulden führen häufig dazu, dass Krankenkassen und Finanzämter als Gläubiger einen Insolvenzantrag stellen. Allerdings gibt es verschiedene rechtliche Möglichkeiten, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen.
1. Prüfung der Forderungshöhe und Berechtigung
Bevor Sie auf einen Insolvenzantrag reagieren, sollten Sie die zugrunde liegende Forderung genau überprüfen:
Besteht die Forderung tatsächlich? Fehler in der Berechnung oder Doppelabrechnungen können vorkommen.
Ist die Forderung bereits verjährt? Sozialversicherungsbeiträge verjähren grundsätzlich nach vier Jahren (§ 25 SGB IV), es sei denn, es liegt vorsätzliches Vorenthalten vor. Steuerschulden unterliegen ebenfalls bestimmten Verjährungsfristen (§ 228 AO).
Wurde die Forderung bereits beglichen oder befindet sie sich in einer laufenden Stundungsvereinbarung? Falls ja, kann der Antrag möglicherweise als unbegründet zurückgewiesen werden.
2. Einwände gegen die Zahlungsunfähigkeit
Um sich gegen den Insolvenzantrag zu verteidigen, können Sie dem Gericht eine positive Fortführungsprognose vorlegen. Hierbei können folgende Nachweise hilfreich sein:
Vorhandene Liquiditätsreserven oder geplante Geldeingänge (z. B. aus Forderungen gegenüber Kunden).
Laufende oder abgeschlossene Finanzierungsverhandlungen, die die Zahlungsfähigkeit sicherstellen.
Vereinbarte Stundungen oder Ratenzahlungen mit Gläubigern, die eine nachhaltige Tilgung der Schulden ermöglichen.
Kurzfristige Zahlungen zur Begleichung der offenen Forderungen, um Zahlungsfähigkeit nachzuweisen.
Gelingt es, dem Gericht glaubhaft darzulegen, dass Zahlungsfähigkeit (wieder) gegeben ist oder in Kürze hergestellt wird, stehen die Chancen gut, dass das Gericht den Antrag ablehnt.
3. Unterscheidung nach Verfahrensabschnitt
Es ist entscheidend, in welchem Verfahrensabschnitt man sich befindet:
Insolvenzeröffnungsverfahren: Bevor das Insolvenzverfahren vom Gericht eröffnet wird, kann man gegenüber dem Insolvenzgericht geltend machen, dass der Antrag unzulässig oder unbegründet ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Forderung nicht besteht (siehe Ziffer 1) oder kein Insolvenzgrund vorliegt (siehe Ziffer 2).
Insolvenzeröffnungsbeschluss: Falls das Insolvenzgericht das Verfahren eröffnet hat, kann nach § 34 Abs. 2 InsO sofortige Beschwerde eingelegt werden. Dabei ist die kurze Frist von zwei Wochen zu beachten.
Wichtig: Der Insolvenzantrag wird nicht allein dadurch unzulässig, dass die Forderung erfüllt wird (§ 14 Abs. 1 S. 2 InsO). Das bedeutet, dass eine nachträgliche Zahlung zwar helfen kann, jedoch nicht zwingend zur Abweisung des Antrags führt.
4. Verhandlung mit der Krankenkasse oder dem Finanzamt
Oftmals kann eine außergerichtliche Einigung mit der Krankenkasse oder dem Finanzamt eine sinnvolle Alternative sein. Möglichkeiten sind:
Stundungen oder Ratenzahlungsvereinbarungen, um eine Rücknahme des Insolvenzantrags zu erreichen.
Vergleichsverhandlungen, bei denen unter Umständen ein Teil der Forderung erlassen wird.
Direkte Kommunikation mit dem Gläubiger, um alternative Lösungen zu besprechen.
Ein erfahrener Anwalt kann hier unterstützen, um die beste Strategie für Ihr Unternehmen zu erarbeiten.
Fazit
Ein Insolvenzantrag durch eine Krankenkasse oder das Finanzamt muss nicht zwangsläufig zur Insolvenz führen. Unternehmen haben verschiedene rechtliche Möglichkeiten, sich zu verteidigen – sei es durch formale Einwände, den Nachweis der Zahlungsfähigkeit oder außergerichtliche Lösungen.
Eine frühzeitige anwaltliche Beratung ist dabei essenziell, um die beste Strategie zu entwickeln und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.