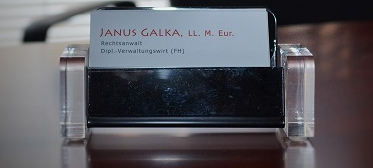Mit dem Beschluss des 8. Senats des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 14. Oktober 2024 (8 B 713/24.AK) hat dieses entschieden, dass zur Genehmigung der Errichtung einer Windenergieanlage bzw. zu deren Betrieb eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach § 6 I 1 WindBG nicht durchgeführt werden muss, wenn es sich um ein gem. § 2 Nr. 1 WindBG ausgewiesenes Windenergiegebiet handelt. Denn § 6 I 1 WindBG regelt grundsätzlich den Ausschluss des UVPG in diesem Fall.
Sachverhalt
Im vorliegenden Fall wurde dem Beigeladenen die Genehmigung zur Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) erteilt. Gegen diese hat eine Nachbarin Klage erhoben, die Eigentümerin eines unter anderem auch zum Wohnzweck genutzten Grundstücks in der Nähe der zu errichtenden Anlage ist. Anfangs handelte es sich hierbei um eine Genehmigung für insgesamt 3 Windenergieanalgen.
Gegen 2 dieser Anlagen ist die Klägerin allerdings im Jahr 2021 vorgegangen; ihre Klagen sind jedoch abgewiesen worden und 2 Windanlagen errichtet worden.
Im Mai 2022 beantragte der Beigeladene die Fortführung des Genehmigungsverfahrens der 3. Windenergieanlage.
Nachdem eine Umweltverträglichkeitsprüfung für diese durchgeführt wurde, wurde dem Antrag im September 2023 stattgegeben. Im Juni 2024 wurde dem Beigeladenen eine Änderungsgenehmigung erteilt. Diese gestattete ihm, die WEA sowohl tagsüber als auch nachts zu betreiben und die Erhöhung der Nennleistung um 200 kW.
Im Juli ließ die Antragstellerin auch die Änderungsgenehmigung in die Klage einbeziehen. Dazu beantragte sie die aufschiebende Wirkung durch ihren Antrag.
Sie machte sowohl die Verletzung von materiellem als auch von Verfahrensrecht geltend.
Entscheidung des OVG Münster
Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz blieb nach summarischer Prüfung des Gericht erfolglos.
In der im Eilrechtsschutz durchzuführenden Interessenabwägung, § 80 V VwGO i.V.m. § 80a III 2 VwGO, zwischen dem sowohl öffentlichen als auch privaten Durchsetzungsinteresse und dem alleinig privaten Interesse der Antragstellerin entschied das Gericht zugunsten des Beigeladenen.
Das Interesse der Antragstellerin überwiegt, wenn der Verwaltungsakt in der Hauptsache als rechtswidrig eingestuft wird und dadurch drittschützende Normen verletzt werden. Im Gegenzug dazu überwiegt das Vollzugsinteresse, wenn der VA, also die Baugenehmigung mit Änderungsgenehmigung, rechtmäßig ist.
So gebe es vorliegend allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass die Baugenehmigung gegen Rechte verstoße, die auch die Antragstellerin schützen sollen, sodass das Interesse auf Aussetzung dem auf Vollzug unterliegt.
Entscheidungsgründe
Die von der Antragstellerin vorgebrachten Rügen des Verfahrens und auch des materiellen Rechts überzeugen voraussichtlich nicht.
Neugenehmigungsverfahren oder Änderungsgenehmigungsverfahren
Nach Ansicht der Antragstellerin ginge es nicht um die Errichtung einer neuen Anlage, sondern um die Erweiterung der bereits bestehenden 2 WEA um eine weitere. Aus diesem Grunde müssen alle drei WEA erneut ein Genehmigungsverfahren und eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Somit hätte anstelle des Neugenehmigungsverfahrens ein Änderungsgenehmigungsverfahren, § 16 I BImSchG, durchgeführt werden sollen.
Der Senat ging allerdings davon aus, dass es der Antragstellerin nicht möglich sei, die Verfahrensart selbst zu rügen. Damit sei auch kein Verfahrensfehler gegeben, der Auswirkungen auf die Genehmigungsentscheidung gehabt hätte und somit zur Aufhebung des Verwaltungsaktes führe.
Gemäß § 4 I 1 Nr. 3 i.V.m. III 2 UmwRG müsse sowohl die Änderung einer bestehenden Anlage wie auch die Neugenehmigung dem § 6 I Nr. 1 BimSchG entsprechen.
Ebenso wurde auf den Prüfungsgegenstand eines Änderungsgenehmigungsverfahrens eingegangen; so sind Hauptbestandteil der unmittelbar zu ändernde Teil der Anlage und die Verfahrensschritte, nicht – wie die Antragstellerin dachte – die wesentliche Erweiterung. Erst wenn sich die Änderung auf den bestehenden Bau oder Teile davon erstrecke, müsse die Prüfung auf diese erweitert werden. Allerdings sei nicht vonnöten, dass die komplette Anlage überprüft wird.
Vorliegend werden die bereits errichteten Windenergieanalgen nicht von der neuen Anlage berührt, sodass eine Prüfung nicht zum Prüfgegenstand gehöre.
Notwendigkeit der UVP im Änderungsgenehmigungsverfahren
Die Antragstellerin brachte hervor, dass ein Verfahrensfehler in der nicht durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung im Änderungsgenehmigungsverfahren bestehe.
Nach Ansicht des Gericht musste allerdings keine erneute UVP im Jahr 2024 durchgeführt werden.
So regele § 9 I 1 Nr. 2 UVPG, dass grundsätzlich eine allgemeine Vorprüfung im Änderungsgenehmigungsverfahren durchzuführen sei, wenn die UVP vor Erteilung der Genehmigung stattgefunden habe. Hierbei sei allerdings nur ausschlaggebend, „ob die Zulassung des bestehenden Vorhabens seinerzeit tatsächlich mit UVP erfolgt ist oder nicht.“ (Rn. 36)
Vorliegend wurde für die Windenergieanlage sogar eine UVP durchgeführt; jedoch hätte das UVPG aufgrund von § 6 I 1 WindBG gar keine Anwendung finden sollen. Denn dieser regele, dass auf eine UVP verzichtet werden könne, „wenn u.a. die Änderung des Betriebs einer Windenergieanlage in einem ausgewiesenen Windenergiegebiet beantragt ist (Satz 1) und das Gebiet nicht in einem Natura 2000 – Gebiet, einem Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark liegt (Satz 2 Nr. 2).“ (Rn. 39)
So seien derartige Windenergiegebiete nach § 2 Nr. 1a) WindBG unter anderem Vorranggebiete und Gebiete in Raumordnungsplänen, die mit Vorranggebieten vergleichbar seien.
Vorliegend befinde sich die streitgegenständliche Windenergieanlage in einem Windenergiebereich des Sachlichen Teilplans Energie des Regionalplans Münster von 2016. Ein derartiger Regionalplan sei ein Raumordnungsplan i.S.d. § 2 Nr. 1a) WindBG, welcher Vorranggebiete für Windenergie ausweise. Hierbei wurde auch eine Umweltprüfung gem. § 8 ROG durchgeführt und es handelte sich weder um ein Natura 2000-Gebiet noch um ein Naturschutzgebiet oder einen Nationalpark.
Somit konnte von einer UVP abgesehen werden.
Verletzung nachbarschützender Vorschriften
Die Antragstellerin machte außerdem geltend, durch Immissionen der WEA wie u.a. Lärm unzumutbar beeinträchtigt zu sein. Ein vorhandenes Schallgutachten habe die Entfernung zwischen den Anlagen und ihrem Grundstück falsch bemessen. Ebenso sei die Windanlage ästhetisch bedrängend.
Nach Ansicht des Gerichtes verletzt die angefochtene Genehmigung inklusive der Änderungsgenehmigung keine nachbarschützenden Belange.
Zum derzeitigen Verfahrensstand konnten keine unzumutbaren Lärmimmissionen festgestellt werden.
Ausschlaggebend für Schallprognosen sei die Nabenhöhe, denn der Lärm der Anlage gehe nicht vom Mastfuß aus, sondern von dem weitaus höher befindlichen Rotor. Somit ist auch der hier vorgesehene Richtwert der Lärmbelastung eingehalten worden.
Auch die weiteren vorgebrachten Bedenken über Infraschall, Schattenwurf, Licht und Eiswurf der Antragstellerin greifen nicht. Ebenso bestehe aller Voraussicht nach kein Verstoß gegen das nachbarrechtliche Rücksichtnahmegebot durch eine bedrängende Wirkung der Windenergieanlage. Gemäß § 249 X BauGB stehe eine optisch bedrängende Wirkung einem Vorhaben nach § 35 I Nr. 5 BauGB nicht entgegen, wenn es der Forschung, Entwicklung oder Nutzung von Windenergie diene und einen gewissen Abstand einhalte. All dies sei hier gegeben.
Überragendes öffentliches Interesse
So stellte das OVG allerdings auch klar, dass selbst wenn man die Erfolgsaussichten der Klage in der Hauptsache als offen betrachten wollte, nichtsdestotrotz in der Vollzugsfolgenabwägung das öffentliche Interesse auf Vollzug das private Interesse der Antragstellerin auf Aufschub überwiegen würde. Denn nach § 2 1 i.V.m. § 3 Nr. 1 EEG sei geregelt, dass die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse stehen. Gemäß § 80c IV VwGO stelle dies einen besonders beachtenswerten Punkt dar.
Anmerkungen
Die vorliegende Entscheidung des OVG Münster schafft weitere Klarheit in der Errichtung von Windenergieanlagen und der damit zusammenhängenden möglichen Problematiken. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf das WindBG gelegt, welches 2023 eingeführt wurde, um die Genehmigung für den Bau erneuerbarer Energieanalgen zu beschleunigen und zu vereinfachen. Vor allem die Anwendung des § 6 I WindBG wird geklärt; dieser soll in bestimmten Fällen dazu führen, dass eine UVP nicht durchgeführt werden muss und auch von einer artenschutzrechtliche Prüfung, § 44 I BNatSchG, abgesehen werden kann.